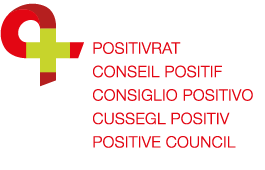Aktuell
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Die Autoren berichten über Veränderungen betreffend Behandlung und Therapieerfolg bei frischen Hepatitis-C Infektionen in der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie vor und nach 2006. Dabei zeigen sich grosse Veränderungen: Seit 2006 wurde vor allem bei Männern, die Sex mit Männern haben, bereits in der frühen Phase behandelt, und der Erfolg dieser frühen Therapien hat sich dadurch signifikant verbessert. Direkte Folge dieses Vorgehens sind deutlich weniger Patienten mit nachweisbarer Hepatitis-C Viruslast. Das aus der HIV-Therapie bekannte Konzept „Behandlung als Prävention“ könnte also auch bei Hepatitis funktionieren.
Ein Vorbehalt vorab: Diese Studie berücksichtigt nur Daten bis und mit 2013. Seither haben sich die verfügbaren Therapien für eine Hepatitis-C Infektion nochmals massiv verbessert, und zwar puncto Wirksamkeit, Pillenanzahl und Nebenwirkungen. Auch dauern die neuen Therapien weniger lang. Trotzdem ist die Studie bedeutend, denn sie gibt uns wichtige Informationen für eine mögliche Hepatitis-C Strategie in der Schweiz.
Warum befasst sich die Studie mit der Situation vor und nach 2006? Seit diesem Zeitpunkt beobachtet die Kohortenstudie eine 18-fache Zunahme der Hepatitis-C Infektionen unter Männern, die Sex mit Männern haben (MSM). Weil nur eine Minderheit der Patienten eine Hepatitis-C Infektion von selber ausheilt, und sich die Hepatitis- und HIV-Infektion gegenseitig ungünstig beeinflussen (der Verlauf beider Erkrankungen wird rascher), könnten die betroffenen Patienten von einer frühen Therapie profitieren. Nachhaltige Heilungsraten von 60-80% wurden beobachtet wenn eine HCV-Therapie innert einem Jahr nach der Diagnose eingeleitet wurde[2]. Es gab aber bisher keinen klinischen Versuch, welche den Erfolg einer frühen mit einer verzögerten Therapie bei HIV/HCV ko-infizierten Patienten verglich. Weil die Kohortenstudie seit 1998 alle Patienten mindestens alle zwei Jahre auf HCV testet, sind diese Patienten viel besser diagnostiziert und charakterisiert als andere von HCV Betroffene.
Die Resultate sprechen eine deutliche Sprache: Der Anteil MSM mit einer akuten Hepatitis-C Infektion betrug vor 2006 24%; er stieg nach 2006 auf 85% an. Vor 2006 wurde weniger als ein Viertel der Patienten mit einer frischen Infektion behandelt (22%); nach 2006 aber fast alle (91%). Unter den heute veralteten Therapien mit Interferon und Ribavirin betrug der Behandlungserfolg bei einer frischen Infektion 78%, bei einer späteren Therapie im chronischen Stadium bloss 29%.
Weil die HCV-Therapien heute noch besser wirken und verträglicher sind, gibt uns diese Studie eine ausgezeichnete Grundlage für neue Versuche. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass eine frühe HCV-Therapie noch besser wirkt, kürzer dauert und zudem zur Verhinderung von Neuansteckungen beiträgt. In der Schweiz ist eine HCV-Therapie in den meisten Fällen erst in einem fortgeschrittenen Stadium möglich, seit September 2015 ab Fibrosegrad F2. Die Kohortenstudie startet im April 2016 mit dem „Swiss HCVree Trial“, der fast allen HIV/HCV ko-infizierten MSM, die an der Kohorte teilnehmen, eine Behandlung und damit eine Heilung der HCV-Infektion ermöglicht.
David Haerry / Oktober 2015
[1]Incident hepaitis C virus infections in the Swiss HIV Cohort Study: Changes in treatment uptake and outcomes between 1991 and 2013; G. Wandeler et al, Open Forum Infectious Diseases, DOI: 10.1093/ofid/ofv026
[2]Diese Hypothese ist heute bereits veraltet, die jetzigen Therapien wirken noch besser.
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
2012 hat die amerikanische Zulassungsbehörde FDA das Therapiemedikament Truvada zur Prä-Expositionsprophylaxe von HIV zugelassen (Pillen davor, statt viele oder gar endlos Pillen danach). Die Erfahrungen der Amerikaner sind gut. Kurz vor der CROI 2015 wurden zwei europäische PrEP-Studien vorzeitig abgebrochen – weil die Intervention so erfolgreich war, dass man den Patienten in den Studienarmen ohne PrEP das Medikament aus ethischen Gründen nicht länger vorenthalten konnte.
Die Post-Expositionsprophylaxe PEP nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr ist in Europa und der Schweiz seit vielen Jahren selbstverständlich. Die entsprechenden Richtlinien wurden in der Schweiz 2014 angepasst, die Kosten für einen Monat Therapie werden von der Grundversicherung übernommen.
Die Geschichte der PrEP, der Pille davor, ist lang. Seit mehr als 10 Jahren weiss man, dass sie zumindest funktionieren könnte. Unglaublich aufwendige Studien wurden mit amerikanischen Geldern - öffentlichen und aus privaten Stiftungen (Gates und Ford Foundation) vor allem in Afrika, Lateinamerika und Asien, aber auch in San Francisco durchgeführt. Die Resultate waren unterschiedlich, doch sie zeigten eines deutlich: Wenn die Pille geschluckt wird, wirkt sie auch. Eigentlich eine banale Erkenntnis. Aufgrund dieser Tatsache hat das FDA die Zulassung im Jahr 2012 durchgesetzt (das FDA ist mächtig und kann eine Zulassung verfügen; die europäischen und die Schweizer Behörden müssen warten, bis eine Firma ein Geschäft wittert und die Zulassung beantragt). Trotz dem schlechten Ruf des amerikanischen Gesundheitssystems funktioniert auch die Kostenübernahme offenbar gut – die Krankenversicherungen machen mit, und wo nicht vorhanden springen Hilfsprogramme ein. Interessant ist auch die Tatsache, dass in den USA die PrEP sehr oft bei Heteropaaren mit Kinderwunsch eingesetzt wird. In der Schweiz würde man einfach den HIV-positiven Partner therapieren, und damit basta.
Aus glatter Verzweiflung über die sehr hohen Neuansteckungsraten bei schwulen Männern haben die Engländer und die Franzosen die bereits erwähnten PrEP-Studien durchgeführt. Die Engländer verglichen in der PROUD-Studie sofortige PrEP mit dem um ein Jahr verzögerten PrEP Einsatz bei schwulen Männern mit hohem Risikoverhalten (Patienten, die wegen Geschlechtskrankheiten spezialisierte Kliniken aufsuchten). Trotz häufigem Einsatz von PEP im verzögerten Arm steckten sich derart viele Männer an, dass die Studie vorzeitig abgebrochen wurde und PrEP an alle Studienteilnehmer abgegeben wurde. Es brauchte 13 therapierte Männer, um eine Neuansteckung zu verhindern. Der deutsche Filmemacher Nicholas Feustel hat eben einen ausgezeichneten Dokumentarfilm zur PROUD-Studie publiziert (in englischer Sprache, aber sehr gut verständlich): https://vimeo.com/132412294
Die Studienanlage war bei den Franzosen etwas anders: Die IPERGAY-Studie rekrutierte schwule Männer, welche innert 6 Monaten mehr als zwei Mal ungeschützten Analverkehr hatten, und man verglich den Einsatz von Truvada als PrEP gegen ein Placebo (Tablette ohne Wirkung) und Präventionsberatung. Ungewöhnlich das Therapieschema der Franzosen: statt Truvada jeden Tag wie Ovomaltine gab es Truvada nur bei Bedarf, wenn Sex geplant war, 4 Pillen insgesamt (zwei davor; einen Tag bis zwei Stunden vor dem Sex; zwei weitere danach, nach 24 und 48 Stunden). Das senkt die Kosten, aber auch die Nebenwirkungen einer Dauertherapie deutlich und sollte auch eine bessere Therapietreue bewirken. Und siehe da: die Resultate der Franzosen waren genau gleich gut wie jene der Engländer, und die Studie wurden wegen Erfolgs vorzeitig abgebrochen.
Erstaunlich ist die Tatsache, dass es nur zwei kleine, vergleichsweise billige Studien brauchte, um die bestehenden Vorurteile gegenüber PrEP über den Haufen zu werfen. Man fragt sich angesichts der riesigen, Hunderte Millionen Dollar verschlingenden Studien im Süden, warum das nicht früher geschah. Doch seien wir nicht kleinlich, wir haben jetzt die Daten, endlich. Aber wie geht es weiter? Truvada hat in Europa nach wie vor keine Zulassung der Behörden für den Einsatz in der Prävention. Weil diese fehlt, übernimmt auch kein System die Kosten. In der Schweiz wissen wir von einigen Ärzten, die bei Bedarf PrEP verschreiben. Die Patienten gehen mit dem Rezept über die Grenze, holen dort ihre Pillen weil sie billiger sind und bezahlen selbst.
Weil das kein Dauerzustand sein kann, hat sich die Arbeitsgruppe Therapie der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit EKSG (früher EKAF) dem Thema angenommen. Von der Truvada Herstellerfirma Gilead wissen wir, dass sie bei der europäischen Behörde eine Zulassung plant und in der Schweiz dasselbe möglich ist. Die Arbeitsgruppe der Kommission wird nochmals die veröffentlichten Daten begutachten und ihre Bedeutung für die Schweiz beurteilen. Man muss sich gut überlegen, für welche Zielgruppe die PrEP kostenwirksam eingesetzt werden kann, wer die PrEP verschreiben soll, wie man die Therapie bei gesunden Menschen überwacht und schlussendlich wer das bezahlen soll. Wenn alles gut geht, erwarten wir eine Empfehlung per Ende 2015. Auch nach dem EKAF-Statement bleibt es spannend in der Prävention. Komplizierter wird es auch, aber das soll uns nicht weiter stören.
Auch wenn PrEP teurer ist als ein Kondom: Die Intervention ist auch wirksamer als der Gummi und ein weiterer, wichtiger Pfeil im Köcher der Prävention.
David Haerry
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Eine Gruppe von Schweizer Forschern hat in einer Studie die Auswirkungen unterschiedlicher Behandlungsstrategien auf die Sterblichkeit und auf die Folgekosten von Hepatitis C untersucht. Ihr Befund: Mit einem früheren Eingreifen und der Durchführung von Screenings liesse sich die Mortalität um 90 Prozent senken und die langfristige Entwicklung der Gesundheitskosten positiv beeinflussen.
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Eigentlich hätte die Medienmitteilung des Universitätsspitals Zürich vom 25. Juni 2015 ein mittleres Erdbeben auslösen sollen . Das mangelnde Echo auf die Studie zur Hepatitis-C-Therapie bestätigt das Bild der „stillen Epidemie“ einmal mehr.
Die eben in PLOS ONE veröffentlichte Modellstudie ist eine eindrückliche Bestätigung des Modells mit Daten der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie, welche an der CROI 2015 vorgestellt wurden (wir berichteten, http://goo.gl/HBoVvh). Der Befund der neuen Studie in Kürze: Eine frühere Therapie und bessere Vorsorgeuntersuchungen senken die Sterblichkeit um 90 Prozent und beeinflussen die langfristige Entwicklung der Gesundheitskosten positiv.
Die Schweizer Forscher haben in der neuen Studie die Auswirkungen unterschiedlicher Behandlungsstrategien auf die Sterblichkeit und die Folgekosten von Hepatitis C untersucht. Bereits bestehende Modelle wurden erweitert, um die möglichen Auswirkungen verschiedener Ansätze zu bewerten: keine Behandlung, Behandlung zur Verminderung von Leberkrebs (Leberkarzinome) und der Sterblichkeit. Dazu wurden auch die Folgekosten einer unbehandelten Hepatitis C im Modell berücksichtigt. Die Ausgangsdaten stammen aus der publizierten Forschung. Die Modelle untersuchten die Auswirkungen der unterschiedlichen Ansätze bis ins Jahr 2030.
Die Ergebnisse könnten deutlicher nicht sein. Unter den heutigen überaus konservativen Behandlungsansätzen betragen die jährlichen Kosten der nicht behandelten Hepatitis C 96,8 Millionen Franken. Man muss es wiederholen: fast 100 Millionen Franken jährliche Kosten für gar nichts, und das Leiden der Patienten kommt dazu.
Wie kriegt man die Sache in den Griff? Das Modell hat die Antwort: Die Sterblichkeit kann um 90% vermindert werden, wenn bis in drei Jahren (2018) jährlich 4'190 Patienten im Stadium F2 oder 3'200 Patienten im Stadium F3 mit den neuen hochwirksamen Therapien behandelt werden. Werden diese Strategien um zwei oder fünf Jahre verzögert, reduziert sich das Todesfallrisiko der Patienten nur um 75, respektive 57%.
Für den Studienleiter und Leberspezialisten Prof. Beat Müllhaupt vom Schweizer Zentrum für Erkrankungen der Leber, der Bauchspeicheldrüse und der Gallenwege (Swiss HPB-Center) am Universitätsspital Zürich (USZ) ist die Sache klar: «Mit einer frühzeitigen Hepatitis C-Therapie kann die Sterblichkeit um 90 Prozent gesenkt und die langfristige Entwicklung der Krankheitskosten positiv beeinflusst werden. Frühe Behandlungen können so die schweren Hepatitis-Folgeschäden und die entsprechenden Folgekosten reduzieren». Er findet es schade, dass die Preisdiskussion um die neuste Generation der Hepatitis C-Medikamente diese gewünschte Behandlung blockiert: «Ich wünsche mir, dass Politik, Industrie und Krankenkassen Lösungen erarbeiten, die den betroffenen Patienten zu Gute kommen.»
Wir pflichten bei und appellieren an alle Beteiligten, das unsägliche Katz- und Mausspiel auf dem Buckel der Patienten zu beenden. Eine rechtzeitige Hepatitis-C Therapie ist ein Menschenrecht und sie muss durch die Grundversicherung ohne Vorbehalte gedeckt werden. Das und nichts anderes ist im Sinn und Geist des Krankenversicherungsgesetzes.
David Haerry
1 http://goo.gl/BncNvr
2 Müllhaupt B, Bruggmann P, Bihl F, Blach S, Lavanchy D, Razavi H, et al. (2015) Modeling the Health and Economic Burden of Hepatitis C Virus in Switzerland. PLoS ONE 10(6): e0125214. doi:10.1371/journal.pone.0125214
Fighting An Uphill Battle – Patienten berichten vom harten Kampf mit den Hepatitis-C-Tripletherapien
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Die HCV Triple Therapie mit den Erstgeneration Proteasehemmern hat sehr viele Nebenwirkungen. Eine qualitative Studie lässt Patientinnen und Patienten zu Worte kommen und zeigt, wie hart diese Therapien sind und wie wichtig der Support durch das Gesundheitspersonal ist.
Die qualitative Studie “Fighting An Uphill Battle” („Kampf gegen den Niedergang“) zeigt eindrücklich, welch harter Kampf die Einnahme der Erstgeneration der direkt-agierenden Medikamente (DAAs) gegen Hepatitis C bedeutet. In Interviews berichteten 13 Patientinnen und Patienten von ihren Erfahrungen mit der Triple-Therapie Interferon, Ribavirin mit einem Proteasehemmer (Boceprevir oder Telaprevir). Trotz hoher Motivation zu Beginn kämpften alle Patienten mit den Nebenwirkungen der Therapie, die bald ihren Alltag dominierte.
Die Heftigkeit der Symptome überstieg die Erwartung der Patienten bei weitem. Diese waren zahlreich, kamen nicht selten aus dem Nichts, und sie waren gesundheitsschädigend oder gar lebensgefährlich. In eindrücklichen Worten schildern die Patientinnen und Patienten ihren Zustand während der Therapieeinnahme. Eine Frau sagte, sie hätte sich wie ein „Zombie“ gefühlt. Die auftretenden Symptome zeigten sich bei vielen in einer Heftigkeit, die sie „am Boden zerstörte“, „räderte“, „schlauchte“, „auf alle Viere“ zwang, „total kaputt“ machte. Die Symptome waren oft so stark, dass sie das Alltagsleben völlig dominierten. Alles drehte sich nur noch um die Bewältigung der Nebenwirkungen.
Die Autoren kommen zum Schluss, dass es beim Management der Symptome früh Unterstützung durch das Gesundheitspersonal braucht, um die Abbruchrate gering zu halten. Entsprechende Schulungen für das Personal sind vorzusehen. Ebenso der Einbezug der Angehörigen. Da es Patienten oft schwer fiel, die vielfältigen und unspezifischen Symptome in Worte zu fassen, empfehlen die Autoren ein patientenorientiertes Assessment-System für die Symptome. Die HCV Triple Therapie wird gegenwärtig durch DAAs der nächsten Generation abgelöst. Diese hätten zwar deutlich weniger Nebenwirkungen, werden dafür aber bei Patienten in späteren Stadien – wenn vermehrt weitere Erkrankungen vorhanden sind – angewandt. Nebenwirkungen können dann durchaus Probleme bereiten. Die Studie zeigt, wie gut geschultes Supportpersonal Patienten mit starken Nebenwirkungen auffangen und motivieren kann.
Fighting An Uphill Battle – experience with the HCV triple therapy: a qualitative thematic analysis, Rasi et al. BMC Infectious Diseases 2014, 14:57
Link zum Originalartikel, frei verfügbar
Seite 6 von 11