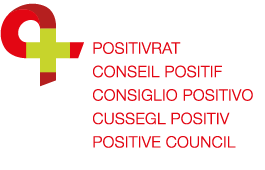Aktuell
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Menschen mit HIV haben heute meist eine recht gute Lebensqualität und ihre Lebenserwartung hat sich dank den hoch wirksamen Therapien praktisch derjenigen der Allgemeinbevölkerung angeglichen. Die erfreuliche Entwicklung, dass Menschen mit HIV älter werden, bringt auch neue Herausforrderungen mit sich. Mit dem Älterwerden treten - nebst den üblichen altersbedingten Beschwerden - auch Langzeitnebenwirkungen der Medikamente oder Langzeitfolgen der HIV-Infektion auf. Probleme können auftreten, wenn der Zeitpunkt kommt, an dem sie Hilfe oder Pflege in Anspruch nehmen müssen, sei dies zu Hause durch Partner, Verwandte, Freunde, durch einen ambulanten Pflegedienst wie Spitex oder gar in der stationären Pflege in einem Spital, einem Alters- oder Pflegeheim.
Die Schweizer Schwulenorganisation PINK CROSS hat kürzlich in Zusammenarbeit mit LOS und den Fachhochschulen Bern und Luzern eine Sensibilisierungsstudie unter dem Titel: «LGBTI- und HIV+/aidskranke Menschen in Alters- und Pflegestrukturen»1 durchgeführt.
Die Untersuchung erfasst die Pflege bei zwei Personengruppen, die zwar eine gemeinsame Schnittmenge haben, sich aber bezüglich ihrer Ansprüche und Bedürfnisse unterscheiden. Nämlich auf der einen Seite die LGBTI, die heute etwas selbstbewusster auftretende Gruppe von Personen, die sich in ihrer Genderidentität vom Mainstream unterscheiden (etwa 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung). Auf der anderen Seite Menschen, die mit einer HIV-Infektion leben. Von diesen sind die meisten heute in antiretroviraler Behandlung und haben somit eine nicht mehr nachweisbare Viruslast, was heisst, dass sie nicht mehr ansteckend sind. Die Zahl der Menschen mit der lebensbedrohenden Krankheit Aids ist heute glücklicherweise klein und wurde in der Studie nicht einbezogen.
Die Studie kommt zum Schluss, dass immer noch nicht sichergestellt ist, dass jeder LGBTI- oder HIV-positive Mensch in einer Alters- und Pflegeeinrichtung voll akzeptiert wird. Die wichtigsten Folgerungen sind:
- In den Leitbildern und Verhaltenscodices wird die Vielfalt der Bewohner nur allgemein thematisiert. Im Bereich LGBTI-Menschen ist also noch Sensibilisierungsarbeit erforderlich.
- Die ambulanten Pflegedienste erfüllen ihre Aufgaben gemäss ihrem jeweiligen Auftrag und nannten kaum Schwierigkeiten.
- In Ausbildungsstätten für Pflegepersonal, insbesondere in den Grundausbildungen, wird das Thema LGBTI-Menschen zu marginal behandelt.
- Es ist durchwegs mehr (Erfahrungs-)Wissen zu HIV-positiven Menschen vorhanden als zu LGBTI-Menschen.
- Das Wissen über Transgender und Intersexualität ist sehr gering oder überhaupt nicht vorhanden.
Leider sind bei medizinischen Fachleuten teilweise immer noch irrationale Ängste vorhanden rund um ältere Menschen mit HIV in der Pflege. Noch zu wenig bekannt ist, dass bei funktionierender antiretroviralen Therapie mit nicht nachweisbarer Viruslast kein Infektionsrisiko mehr besteht, weder für die Pflegenden noch für die Mitpatienten. Besondere Hygienemassnahmen sind nicht erforderlich; sie werden von den Betroffenen als diskriminierend empfunden.
Die Pflege älterer Patienten umschliesst heute auch Menschen mit HIV. Das Pflegepersonal muss sich deshalb mit den Krankheitsbildern auseinandersetzten und es muss wissen, dass eine HIV-Infektion – oder die Medikamente – den Alterungsprozess möglicherweise beschleunigen (Arthrose, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Beschwerden, psychische und psychosomatische Störungen, etc.). Gerade bei älteren Patienten mit HIV ist die Adhärenz wichtig. Die Pflegenden müssen besonders bei Patienten mit hirnorganischen Störungen hierauf achten.
Auch das psychosoziale Umfeld muss beachtet werden: Häufig kommt es auch von Seite der Mitpatienten bzw. -bewohner zu Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit HIV, da dieser Themenkreis immer noch weitgehend tabuisiert ist.
Schliesslich seien noch die Persönlichkeitsrechte der HIV-Infizierten erwähnt. Niemand ist verpflichtet, eine HIV-Infektion offenzulegen. Und das Pflegepersonal – falls es davon Kenntnis hat – muss damit verantwortungsvoll und diskret umgehen.
Ein gewisses Minimum an Informationen über den Umgang mit Menschen mit HIV sowie mit älteren LGBTI und deren Erwartungen und Bedürfnisse sollte auch in den Ausbildungskursen Eingang finden. Die Themenbereiche LGBTI und HIV/Aids müssen zudem in den Leitbildern der Pflegeinstitutionen besser verankert werden und das Pflegepersonal muss hierfür sensibilisiert werden.
PINK CROSS und LOS planen, die Studie weiterzuführen und um die Perspektive der Betroffenen selbst zu erweitern.
Hansruedi Völkle / März 2017
1 Siehe : http://www.pinkcross.ch/lebenswelten/sensibilitaet-fuer-lgbti-im-alter
- Details
- Kategorie: Kohorten-News SHCS
Arbeitsfähigkeit und Beschäftigungsrate von HIV-infizierten Personen, welche in der Schweizerischen HIV Kohortenstudie unter einer antiretroviralen Therapie stehen.
Open Forum Infectious Diseases
Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Lebenserwartung von HIV-infizierten Personen aufgrund der Verfügbarkeit von wirksamen antiretroviralen Therapien (ART) derjenigen der Allgemeinbevölkerung angeglichen. Daraus resultierend hat sich auch die Arbeitsfähigkeit und die Erwerbstätigenrate von HIV-infizierten Personen verbessert, welche früher aufgrund von HIV-bedingten Erkrankungen nicht mehr arbeitsfähig waren. Die Autoren Elzi und Kollegen haben in der vorliegenden Studie die Arbeitsfähigkeit und die Beschäftigungsraten von 5'800 Personen aus der Schweizerischen HIV Kohortenstudie (SHCS) untersucht, welche unter einer wirksamen ART stehen. Die Autoren haben angeschaut, welche Faktoren eine Wiederaufnahme der Arbeitsfähigkeit ein Jahr nach Beginn der ART begünstigen, haben einen Vergleich der Arbeitsfähigkeitsraten über eine Zeitperiode von 5 Jahren angestellt und Risikofaktoren ermittelt, welche zu einer Arbeitsunfähigkeit führen.
Zu Beginn der Studie, bevor die Personen mit ihrer ART starteten, waren 8.1% der Personen nur teilweise und 16.3% der Personen vollständig arbeitsunfähig. Von den Personen, welche vor ART-Beginn arbeitsunfähig waren, blieben 53.6% auch ein Jahr danach arbeitsunfähig.
- Faktoren, welche ein Wiedererlangen der vollen Arbeitsfähigkeit begünstigten, waren
- eine nicht weisse Ethnizität,
- ein hoher Bildungsgrad,
- eine T-Helferzahl über 500 Zellen/µl,
- eine unterdrückte HIV Viruslast ein Jahr nach Beginn der ART und
- ein Einschluss in die Studie zu einer späteren Studienperiode.
Im Gegenteil hierzu waren
- ein höheres Alter,
- eine psychiatrische Erkrankung und
- die Teilnahme an einem Opiat-Programm
mit einer tieferen Wahrscheinlichkeit vergesellschaftet, die Arbeitsfähigkeit wiederzuerlangen.
Das Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit 1 Jahr nach Beginn der ART stieg von 24% in der Studienperiode 1998-2001 auf 41.2% in der Studienperiode 2009-2012 markant an, allerdings kam es dabei nicht zu einem begleitenden Anstieg der Beschäftigungsrate.
Zusammengefasst reflektiert die Studie die markant verbesserte Prognose von HIV-infizierten Personen, welche unter einer ART stehen. Erfreulicherweise ist die Arbeitsfähigkeit in dieser Personengruppe über die letzten Jahre deutlich angestiegen, allerdings bleibt eine Diskrepanz zu dem nach wie vor tiefen Beschäftigungsgrad. Dies zeigt auf, dass nach wie vor Hürden bei der Reintegration von HIV-infizierten Personen in den Arbeitsprozess bestehen und hierfür Lösungen gesucht werden müssen. Als Ansätze könnten Beschäftigungsprogramme, ein Angebot an Teilzeitarbeit, die Ausbildung entsprechender Fachpersonen und ein gezielter Austausch zwischen Arbeitgebern und dem Gesundheitswesen dienen.
Kommentar Positivrat:
Über diese Publikation haben wir im Frühjahr bereits berichtet:
http://neu.positivrat.ch/medizin/studien/159-arbeitsfaehigkeit-und-beschaeftigungsgrad-von-menschen-mit-hiv-unter-antiretroviraler-therapie.html
- Details
- Kategorie: Kohorten-News SHCS
In welchen Abständen soll bei Patienten aus Ländern mit einem hohen Einkommen die unter einer wirksamen antiretroviralen Therapie stehen die HIV-Viruslast und die CD4-Zellzahl gemessen werden, um das Auftreten von Tod und AIDS-definierenden Erkrankungen reduzieren zu können?
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
In der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie (SHCS) messen wir bei Patienten, welche unter einer wirksamen antiretroviralen Therapie (ART) stehen und bei denen die HIV-Viruslast unter der ART unterdrückt ist alle 3 Monate die HIV-Viruslast und die CD4-Zellzahl.
Caniglia und Kollegen haben in der vorliegenden Arbeit untersucht, welchen Einfluss eine Ausdehnung der Messungen auf 6- oder 9-12 monatliche Abstände bei Patienten aus Ländern mit hohem Einkommen auf die Wahrscheinlichkeit zu sterben oder an einer AIDS-definierenden Erkrankung zu erkranken hat.
Im Vergleich zu der 3-monatlichen Messung der HIV-Viruslast und der CD4-Zellzahl war bei Patienten mit einem verlängerten Messintervall alle 6 oder alle 9-12 Monate das Risiko zu sterben oder an einer AIDS-definierenden Erkrankung zu erkranken nicht erhöht. Allerdings zeigte sich, dass bei Patienten bei denen die HIV-Viruslast oder CD4-Zellzahl nur alle 9-12 Monate gemessen wurde ein virologisches Versagen (Viruslast >50 Kopien/ml Blut) signifikant häufiger auftrat. Bei einem 6 monatlichen Messintervall bestand kein erhöhtes Risiko eines virologischen Versagens.
Zusammenfassend fanden sich in dieser Studie keine Anhaltspunkte, dass bei Patienten unter ART mit einer unterdrückten Viruslast eine Ausdehnung der Messintervalle der HIV-Viruslast von 3 auf alle 6 oder 9-12 Monate die Sterblichkeit oder die Wahrscheinlichkeit für eine AIDS-definierende Erkrankung erhöht.
Kommentar Dr. Dominique Braun und Dr. Huldrych Günthard
Die Autoren der Studie ziehen den Schluss, dass bei Patienten unter einer wirksamen ART eine Ausdehnung der Messintervalle der CD4-Zellzahl und der HIV-Viruslast von 3 auf 6 oder 9-12 Monate keinen Einfluss auf die Sterblichkeit oder das Auftreten von AIDS-definierenden Erkrankungen hat. Es ist aus unserer Sicht jedoch wichtig zu realisieren, dass bei dem 9-12 monatlichen Messintervall ein virologisches Versagen signifikant häufiger aufgetreten ist.
Aus diesem Grund empfehlen wir mit Nachdruck, in der SHCS die HIV-Viruslast weiterhin alle 3 Monate zu messen oder die Messung höchstens auf 6 monatliche Intervalle auszudehnen.
Kommentar Positivrat
Ältere Patienten haben sich mit den regelmässigen Kontrollvisiten alle drei Monate, inklusive Bestimmen der Laborwerte arrangiert. Aus jahrelanger Erfahrung liess sich ableiten, dass eine erfolgreiche Langzeitüberwachung möglicherweise mit weniger häufigen Kontrollen möglich ist. Diese Publikation bestätigt die Vermutung, zeigt aber auch die Grenzen.
Es ist erfreulich, dass die Therapien mittlerweile so stabil und verträglich sind, dass weniger häufig überwacht werden muss. Aus Patientenperspektive möchten wir aber betonen, dass am Anfang einer Therapie – die ersten zwei Jahre sowie nach Therapieumstellungen – am 3-Monatsintervall festgehalten werden sollte. Patienten die sich psychisch nicht so fit fühlen, mit Depressionen kämpfen, unerwartete Nebenwirkungen feststellen, während einer Schwangerschaft oder sonstigen Erkrankung sollte man sich auf jeden Fall häufiger oder sofort in der behandelnden Klinik melden. Die Therapietreue (Adhärenz) ist auf Dauer eine grosse Herausforderung für alle Patienten. Die regelmässige Konsultation spielt hier eine wichtige Rolle. Siehe dazu auch den nächsten Artikel (Glass et al.)
David Haerry / November 2016
- Details
- Kategorie: Kohorten-News SHCS
Einfluss der antiretroviralen Therapieadhärenz auf das Risiko eines virologischen Versagens und die Sterblichkeit.
AIDS
Adhärenz bezeichnet das Ausmass, in dem die Medikamenten-Einnahme mit den Empfehlungen des Arztes/der Ärztin übereinstimmt, auch Therapietreue genannt.
Glass und Kollegen haben in der vorliegenden Arbeit den Einfluss der antiretroviralen Therapie- (ART) Treue (sog. Therapieadhärenz) auf die Wahrscheinlichkeit eines virologischen Versagens und auf die Patientensterblichkeit untersucht.
Es zeigte sich, dass ein Auslassen von zwei oder mehr ART-Dosen innerhalb der vorangegangenen 4 Wochen das Risiko eines virologischen Versagens um das Fünffache erhöhte. Die Wahrscheinlichkeit eines virologischen Versagens lag dabei umso höher, je mehr ART-Dosen die Patienten ausgelassen hatten.
Bei Patienten, welche zwei oder mehr ART-Dosen in den vorangegangenen 4 Wochen vergessen hatten, war die Sterblichkeit ebenfalls um das Fünffache erhöht.
Diejenigen Patienten, welche unter einer einmal täglich einzunehmenden ART standen, hatten bei Vergessen einer ART-Dosis ein höheres Risiko für ein virologisches Versagen im Vergleich zu den Patienten, welche unter einer zweimal täglich einzunehmenden ART standen.
Die Studie zeigt eindrücklich, dass eine verminderte Therapieadhärenz zu einem deutlich erhöhten Risiko für ein virologisches Versagen führt und die Sterblichkeit erhöht.
Das Erfragen der ART-Adhärenz anlässlich der ärztlichen Kontrollen ist deshalb entscheidend und kann helfen Patienten zu identifizieren, welche ein Risiko für einen ungünstigen Therapieverlauf aufweisen. Es ist deshalb aus ärztlicher Sicht wichtig, zusammen mit dem Patienten die Gründe für eine unregelmässige ART-Einnahme zu untersuchen und mit dem Patienten Strategien zu entwickeln, welche die Regelmässigkeit der ART-Einnahme gewährleisten.
Kommentar Positivrat
Was die HIV-Patienten puncto Adhärenz und Therapietreue erreichen, ist ausserordentlich. Bei akuten Erkrankungen schaffen die Patienten - wenn es gut geht - eine Adhärenz von 60% bis 65%. Bei chronischen Erkrankungen sind die Werte generell etwas besser. Kaum jemand erreicht jedoch Werte von 95% und sogar mehr, wie dies von HIV-Patienten gefordert wird.
Die vorliegende Studie zeigt deutlich den Stellenwert einer sehr guten Arzt-Patientenbeziehung. Wer Schwierigkeiten hat mit dem pünktlichen Pillenschlucken sollte das mit dem Behandler besprechen und nach Lösungen suchen. Dafür muss man sich nicht schämen, denn diese Schwierigkeiten sind menschlich und verständlich. Wenn eine Therapie versagt, bilden sich Resistenzen. Es gibt zwar Alternativen, doch sind diese vielleicht nicht ganz so gut verträglich oder komplizierter. „Virologisches Versagen“ und „erhöhte Sterblichkeit“ tönen nicht nur dramatisch, sie sind es auch.
David Haerry / November 2016
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Im letzten Newsletter vom Oktober haben wir das Herzinfarktrisiko im Zusammenhang mit Abacavir thematisiert 1. In unserem Kommentar haben wir dieses Risiko in einen grösseren Zusammenhang gestellt, und dabei auch Rauchen und Kokainkonsum angeschaut.
Vom 26. bis 27. September fand in Washington D.C. der «7th International Workshop on HIV and Aging» statt. Die Forscher Althoff, Gange und Gebo präsentierten dort eine Studie aus der nordamerikanischen Kohorte NA-ACCORD. Sie hatten dabei Daten von 29'000 Patienten analysiert.
Ihre Schlussfolgerungen sind deutlich: Nichtrauchen und Blutdruck kontrollieren senkt das Herzinfarkt Typ 1 Risiko um einen Drittel, Typ 2 um einen Viertel.
David Haerry / November 2016
Seite 1 von 11