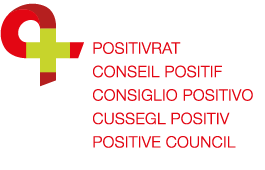Aktuell
Neues aus der Kohortenstudie SHCS – HIV-positive Leber verlängert das Leben eines Menschen mit HIV 1
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
In den meisten Ländern ist HIV-positiven Menschen die Organspende nicht erlaubt. In der Schweiz wurde die Gesetzgebung 2007 geändert. In Genf wurde nun erstmals einem HIV-positiven Patienten die Leber eines HIV-positiven Spenders transplantiert. Sowohl Spender und Empfänger wurden seit vielen Jahren therapiert, und beide hatten dokumentierte, aber kontrollierte Mehrfachresistenzen. Fünf Monate nach dem Eingriff geht es dem Organempfänger sehr gut. Eine Organspende zwischen HIV-Positiven ist also möglich.
Aufgrund vieler Befürchtungen ist die Organspende von HIV-positiven Spendern in den meisten Ländern nicht erlaubt. In den USA alleine führt diese Haltung zu einem jährlichen Verlust von ungefähr 350 Organspenden. HIV-positive Patienten, die auf ein neues Organ warten, werden auf den Wartelisten diskriminiert. Das Todesfallrisiko ist bei HIV-positiven Empfängern höher – das gilt vor allem bei mit Hepatitis C ko-infizierten Patienten. Grund für das hiesige Verbot einer Transplantation HIV-positiver Organe ist die Annahme, dass bei einer Organtransplantation von einem HIV-positiven Spender auf einen HIV-positiven Empfänger ein anderer HI-Virustyp übertragen wird, welcher beim Empfänger nicht mehr kontrolliert werden kann. Dadurch könnte das Immunsystem des Empfängers überlastet werden, und es könnten sogenannte opportunistische Infektionen auftreten.
Bis jetzt wurden nur in Südafrika die Nieren HIV-positiver Spender an ebenfalls HIV-positive Empfänger transplantiert. Die Spender waren entweder noch gar nicht therapiert, oder sie hatten noch keinen Therapiewechsel hinter sich. In den USA sind solche Transplantationen seit 2013 gesetzlich möglich, doch braucht es zur Ausführung ein bewilligtes Forschungsprotokoll, was wiederum eine unnötige Hürde ist. Zwischen 2008 und 2014 sind in der Schweiz 569 HIV-positive Menschen verstorben, davon rund 80 an einem Leberversagen. 14 HIV-positive Menschen bekamen in dieser Zeitspanne die Leber eines HIV-negativen Menschen transplantiert. Dieser Artikel dokumentiert die erste Lebertransplantation eines HIV-positiven Spenders zu einem HIV-positiven Empfänger.
Empfänger und Spender
Einem 53-jährigen HIV-positiven Mann wurde die Leber eines im Oktober 2015
verstorbenen Spenders angeboten. Der Empfänger ist seit 1987 HIV-positiv und hat sich als Drogenkonsument angesteckt. Beim Empfänger wurden zusätzlich 1997 eine Hepatitis C diagnostiziert. 2004 war diese ohne Therapie spontan geheilt. Ebenfalls hatte er früher mal eine ebenfalls spontan ausgeheilte Ansteckung mit einer Hepatitis B Infektion. Eine fortschreitende Hepatitis D wurde 2011 diagnostiziert. Diese wurde mit pegyliertem Interferon behandelt, doch die Therapie wurde vom Patienten nicht vertragen. Seit November 2014 war der Empfänger auf der Warteliste für eine Spenderleber. Sein Zustand verschlechterte sich im Sommer 2015 dramatisch.
Der Spender war ein 75-jähriger Mann, der an einer Hirnblutung verstorben ist. Er war bisexuell und wurde 1989 als HIV-positiv diagnostiziert. Spender und Empfänger hatten aus frühen Therapiekombinationen Resistenzen, waren aber erfolgreich therapiert, mit einer Viruslast unter der Nachweisgrenze. Beim Empfänger schwankten die CD4 zwischen 300 und 400 Zellen pro Mikroliter, beim Spender zum Zeitpunkt des Todesfalls 298 Zellen pro µl . Der Spender erfuhr von seinem Arzt über die Möglichkeit der Organspende, und er gab im September 2015 sein schriftliches Einverständnis. Von beiden Patienten waren die Resistenzen dokumentiert. Der Empfänger wurde vor dem Eingriff über die Resistenzen des Spenders und die dadurch nötige Therapieumstellung informiert. Er nahm das Risiko auf sich und erklärte schriftlich sein Einverständnis.
Eingriff und nachfolgende Behandlung
Die transplantierte Leber funktionierte nach dem Eingriff sofort normal. Am zweiten Tag nach dem Eingriff wurde die antiretrovirale Therapie wieder eingeleitet. Die Basistherapie rilpivirine/tenofovir/emtricitabine wurde zusätzlich mit raltegravir und enfuvirtide verstärkt. Es wurden weitere Posttransplantationsmedikamente verabreicht. Die HIV-Therapie wurde drei Monate nach dem Eingriff wieder vereinfacht.
Schlussfolgerungen und Kommentar
Die erfolgreiche Transplantation einer Leber eines HIV-positiven Spenders zu einem HIV-positiven Empfänger ist in vieler Hinsicht eine Revolution. Bisher wurden bloss 27 Nieren an HIV-positive Empfänger in Südafrika transplantiert. Bei diesen Fällen ist die Erfolgsrate gleich gut wie bei HIV-negativen Empfängern. Im Fall aus Genf waren Spender und Empfänger seit ca. 30 Jahren HIV-positiv, hatten mehrere Therapiewechsel hinter sich und auch unterschiedliche Resistenzprofile. Deshalb wurde die HIV-Therapie beim Empfänger nach dem Eingriff massiv ausgebaut– sogar das vergessene Enfuvirtide (Fuzeon) wurde aus dem Dornröschenschlaf geholt. Fünf Monate nach dem Eingriff geht es dem Patienten sehr gut. Auch die dreifache Hepatitis-Infektion spielte keine negative Rolle.
Trotz des Erfolgs bleibt ein solcher Eingriff eine Herausforderung. Medikamenteninteraktionen sowie die immunologische und virologische Kontrolle können Probleme verursachen und die medizinische Vorgeschichte sowohl des Spenders wie des Empfängers müssen lückenlos bekannt sein. Dieser Artikel ist auch eine Aufforderung an Menschen mit HIV, ihre Bereitschaft zur Organspende bei der nächsten Arztvisite zu bekunden. Auch Sie können Leben retten!
David Haerry / Oktober 2016
1 Alexandra Calmy et al, Swiss HIV and Swiss Transplant Cohort Studies, American Journal of Transplantation 2016; XX: 1–6, doi: 10.1111/ajt.13824
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Am 22. Juli hat die EMA das in der HIV-Therapie verbreitete Truvada für den Einsatz in der Prävention zur Zulassung empfohlen.
Wir kommen im nächsten Newsletter darauf zurück.
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Die Behandlung der Hepatitis C Virus (HCV) Infektion mit den neuen hochwirksamen Anti-HCV Medikamenten ist in vielen Ländern aufgrund des hohen Preises dieser Medikamente erst bei Patienten mit einem fortgeschrittenen Leberschaden erlaubt.
Zahnd und Kollegen haben nun ein Modell entwickelt, um die Auswirkung einer HCV-Behandlung auf Leber-bedingte Erkrankungen und die Sterblichkeit in Abhängigkeit des Stadiums des Leberschadens zum Zeitpunkt des Therapiebeginns zu untersuchen. Die Autoren konnten in ihrem Model zeigen, dass ein verzögerter Therapiebeginn das Risiko an der HCV-Infektion zu sterben oder an schweren Leberkomplikationen zu erkranken um ein vielfaches erhöht und letztendlich keine kosteneinsparende Massnahme darstellt.
Diese Studiendaten unterstützen das Vorgehen, bei allen HCV-infizierten Personen bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine HCV-Therapie einzuleiten und nicht abzuwarten, bis die Komplikationen der HCV-Infektion aufgetreten sind. Damit dieses Vorgehen für das Gesundheitssystem erschwinglich ist, müssten allerdings die zurzeit sehr hohen Medikamentenpreise nachhaltig gesenkt werden.
Danièle Perraudin / Juli 2016
Publikation im Journal of Hepatology 2016
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Die Eidgenössische Kommission für Aidsfragen (EKAF, heute EKSG) wirbelte 2008 noch einigen Staub auf als sie sagte, ungeschützter Sex unter sero-diskordanten Paaren bedeute kaum ein Risiko, wenn der infizierte Partner seit mindestens 6 Monaten erfolgreich therapiert sei. Die eben publizierte Partner-Studie beweist jetzt: die EKAF hatte recht. Eine rasche und funktionierende Therapie aller Menschen mit HIV ist die beste Prävention. Die Daten wurden an der Welt-Aids Konferenz in Durban präsentiert und eifrig diskutiert.
Die Partner-Studie zeigt uns deutlich, dass bei unterdrückter Viruslast kein HIV übertragen wird. Zwar hatten frühere Studien bereits Hinweise geliefert, doch waren dort die Teilnehmer heterosexuelle Paare und viele von ihnen verwendeten Kondome. In der Partner-Studie jedoch wurden sowohl schwule wie auch heterosexuelle und sero-diskordante Paare eingeschlossen die beim Sex aufs Kondom verzichten. Dadurch wurde die Studie genauer, denn die Beobachtungszeit von Paaren, welche beim Sex aufs Kondom ganz verzichten, war sehr viel länger.
Insgesamt elf bei Studienstart HIV-negative Partner haben sich infiziert – 10 schwule Männer und eine heterosexuelle Person. Die Infektionen stammten aber alle nicht vom HIV-positiven festen Partner. Acht von elf Personen räumten denn auch ein, ungeschützten Geschlechtsverkehr ausserhalb der Partnerschaft praktiziert zu haben.
Interessant ist auch der Hinweis, dass 91 der HIV-positiven Teilnehmer eine sexuell übertragbare Krankheit während der Studie behandeln liessen – fast gleich viele wie bei den HIV-negativen. Auch in dieser Situation gab es kein erhöhtes Risiko einer HIV-Übertragung.
Um die Sicherheit der Daten noch zu verbessern, wird die Studie weitergeführt und es werden zusätzliche schwule Paare aufgenommen.
Diese Daten sind einfach zu verstehen: 58'000 mal ungeschützten Sex (ohne Kondome) und keine einzige HIV-Übertragung. Damit dürfen wir es laut sagen: Es besteht kein Risiko einer HIV-Übertragung bei einer nicht nachweisbaren Viruslast. Weder andere sexuell übertragbare Krankheiten noch sogenannte „Blips“ 2 haben daran etwas geändert.
Was keine klinische Studie völlig ausschliessen kann, ist dass trotzdem eine Übertragung stattfinden könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist aber derart gering, dass wir uns deswegen den Kopf nicht weiter zerbrechen sollten – eine Übertragung ist fast unmöglich. Diese Studie sollte also zu Normalisierung von HIV beitragen und sich positiv auf Stigma und Diskriminierungen auswirken.
In sehr vielen Ländern gibt es noch immer Gesetze, welche Menschen mit HIV kriminalisieren, und dabei von Risiken ausgehen, welche mit dieser Studie eindeutig widerlegt werden. Menschen mit HIV welche mit HIV-negativen Partnern Sex haben, werden dort bestraft, auch wenn ein Kondom eingesetzt oder die Viruslast nicht nachweisbar ist. In der Schweiz besteht die Gefahr seit Inkrafttreten des neuen Epidemiengesetzes per 1. Januar 2016 nicht mehr 3 - bestraft werden nur noch effektiv erfolgte Infektionen mit böswilliger Absicht (wie das traurige Beispiel des Berner Heilers).
Im Journal der American Medical Association, wo die Partnerstudie am 12. Juli publiziert wurde, wurde gleichzeitig auch ein Editorial veröffentlicht, welches sich mit der Sicherheit des kondomfreien Sex durch HIV-Positive beschäftigt. 4 Diese Ausführungen tragen mit Sicherheit zur weiteren Verwirrung des Publikums bei und dienen vor allem dem Ego der Autoren. Seriöse Wissenschaft im Dienste des Menschen ist das nicht.
David Haerry / Juli 2016
1 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2533066
2 Blips sind kleine, kurzfristige Erhöhungen der Viruslast, die ab und zu gemessen werden.
3 http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Der-Bund-will-die-Uebertragung-von-Aids-entkriminalisieren/story/27104301
4 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2533043
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Noch vor zehn Jahren waren Therapieresistenzen das grosse Schreckgespenst in der HIV-Therapie. Vielen Patienten sass die pure Angst im Nacken – wie lange hält und wirkt die Therapie? Sind irgendwann alle Patienten multiresistent und austherapiert? Eine eben publizierte Studie der HIV-Kohorte gibt Entwarnung – definitiv.
1987 wurde AZT als das erste HIV-Medikament durch die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) zugelassen. AZT (Handelsname Retrovir), ist noch immer erhältlich, spielt aber in der heutigen Therapie kaum mehr eine Rolle.
Eingesetzt wurde AZT damals als Monotherapie. Schon bald zeigte sich, dass das Medikament nach wenigen Monaten nicht mehr wirksam war – die Viren waren resistent geworden. Damals hatte man das Phänomen zwar beobachtet, aber noch nicht richtig begriffen. Gute fünf Jahre später schafften weitere Medikamente derselben Substanzklasse die Zulassung. Wenn man nun beim Therapiebeginn gleich zwei Substanzen benutzte, war die Therapie etwas länger wirksam. Der definitive Durchbruch kam aber erst 1995 mit der Zulassung der ersten Proteasehemmer: wurde diese neue Substanzklasse mit zwei Molekülen der NRTI-Klasse kombiniert, dann funktionierte die Therapie dauerhaft. Die HIV-Kombinationstherapie war geboren.
Die damaligen Therapieschemen waren aber eine Zumutung für die Patienten. Viele, sehr viele Tabletten zwei- oder dreimal am Tag, teils mit, teils ohne Essen – der Alltag drehte sich förmlich um die Pillen. Hinzu kamen die zum Teil schweren Nebenwirkungen – auf Dauer waren die meisten Patienten von der Therapie überfordert.
Viele Patienten hatten damals auch eine Therapiegeschichte mit Mono- oder Dualtherapien. Resistenzen waren also bereits vorhanden, und der neue Proteaseinhibitor wurde einfach aufgepfropft, und damit eine neue Einzelsubstanz zu den mehr schlecht als recht funktionierenden NRTIs zugefügt. Dann kam die nächste Studie, die nächste neue Substanz, wieder obendrauf – und nach ein paar Monaten entstanden wieder neue Resistenzen. Ein nicht enden wollender Kreislauf des Versagens.
Nach dem Jahr 2000 konzentrierte sich die HIV-Medikamentenentwicklung auf zwei Prioritäten:
- Neue Therapien mussten gegen resistente Viren wirksam sein
- Die Therapien mussten unbedingt besser verträglich und die Dosierungen einfacher sein
Man hat damals auch gelernt, dass bei vorbehandelten Patienten eine Therapieumstellung nur funktioniert, wenn mindestens zwei Medikamente aus zwei Klassen voll wirksam sind, und dass man vor dem Therapiebeginn einen Resistenztest machen muss, weil eventuell resistente Viren übertragen wurden.
Ab ungefähr 2008 kam eine Welle neuer Medikamente (z.B. Integrasehemmer, neuere Proteasehemmer und NNRTIs) auf den Markt – diese erfüllten die eben erwähnten Kriterien der besseren Verträglichkeit, einfacheren Dosierung und Wirksamkeit trotz bestehender Resistenzen. Die grosse Zahl neuer Therapien in verschiedenen Klassen half auch den alten, multiresistenten Patienten aus der Sackgasse. Mit ganz wenigen Ausnahmen konnten neue, verträgliche und wirksame Kombinationen verabreicht werden. Enfuvirtide oder T-20, das zweimal täglich zu spritzende, sehr teure Präparat der allerletzten Wahl wurde zum Ladenhüter.
Die Autoren konnten in der aktuellen Studie zeigen, dass die Entstehung neuer Resistenzmutationen zwischen 1999 und 2013 dramatisch von 401 auf 23 Patienten zurückgegangen ist.
Die Studie zeigt, dass die Resistenzbürde in der HIV-Kohortenstudie ein Relikt aus den Anfangsjahren der Therapie darstellt, als die Medikamente noch nicht in Kombination eingesetzt wurden. Die Entstehung von Resistenzen konnte mit der Einführung von neuen Substanzen ab 2006 praktisch gestoppt werden, und nur acht Patienten mit Therapiestart nach 2006 entwickelten eine 3-Klassen Resistenz.
Resistenzen in der SHCS
| Therapiebeginn | Vor 1999 | 1999-2006 | 2007-2013 |
|
Resistenzen nachgewiesen |
56% | 20% | 10% |
| NNRTI Resistenzen | 18% | 8% | 4% |
| NRTI Resistenzen | 54% | 16% | 5% |
| PI Resistenzen | 28% | 7% | 2% |
|
Resistent gegen 2 Klassen |
22% | 8% | 1.7% |
Ist nun wirklich alles in Butter?
Für Schweizer und Europäer sind wir sicher. In ärmeren Ländern, insbesondere in Sub-Sahara Afrika aber auch in Osteuropa gilt das nicht. Die in diesen Ländern eingesetzten Erst-Therapien genügen den Anforderungen nicht, und die Instrumente um die Resistenzprobleme rechtzeitig festzustellen, sind nicht da. Die Zweit-Therapien sind um ein Vielfaches teurer als die Ersttherapien. Diese Länder brauchen deshalb dringend wirksamere und gleich billige Ersttherapien. Nur dann können auch sie der Resistenzfalle entrinnen.
David Haerry / Juli 2016
1 Alexandra Scherrer et al, Swiss HIV Cohort Study SHCS, Clinical Infectious Diseases May 15, 2016, DOI: 10.1093/cid/ciw128
Seite 3 von 11