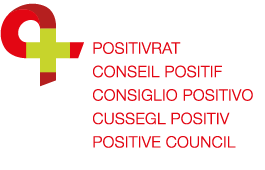Aktuell
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Im Januar 2008 publizierte die Eidgenössische Kommission für Aidsfragen (EKAF) das vieldiskutierte Positionspapier zum Transmissionsrisiko unter Therapie bei Menschen mit HIV. In der Zwischenzeit hat sich seitens der Forschung bereits einiges getan. Insgesamt wird der Standpunkt der EKAF bislang bestätigt.
An der Conference of Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) im Februar 2010 wurden zu diesem Thema zwei aufschlussreiche Studien präsentiert. In der ersten untersuchte eine Forschergruppe aus San Francisco die Hypothese, ob eine Senkung des Community Viral Load (CVL), also der Viruslast in der Gesamtbevölkerung, mit einer Reduktion der Neuinfektionen einherginge.(1) Das-Douglas und Kollegen gelang der Nachweis, dass von 2002 bis 2008 der CVL sowohl im Durchschnitt wie auch insgesamt sank, und dass dies mit einer Senkung der Zahl neuer HIV-Infektionen einherging. Laut den Autoren liegen die Ursachen in verbesserten Therapieoptionen sowie besserer Therapieabdeckung und erhöhtem HIV-Statusbewusstsein. San Francisco empfiehlt in der Folge seit April 2010 den sofortigen Einsatz der antiretroviralen Therapie (ART) nach einer HIV-Diagnose (2) - ein international allerdings umstrittener Entscheid.
ART schützt zuverlässig im festen Paar
Eine südafrikanische Studie befasste sich mit dem Übertragungsrisiko in serodiskordante, heterosexuellen Partnerschaften. Die Daten zeigen eindrücklich ein um 92% vermindertes Übertragungsrisiko, wenn der HIV-infizierte Partner therapiert wird.(3) Die angestrebte hundertprozentige Kondombenutzung schneidet im Vergleich dazu schlechter ab – das Übertragungsrisiko wird hier um ca. 85% gesenkt. Diese Studie bestätigt die Therapie klar als bisherige wirksamste Intervention in der Prävention. Diese Daten für serodiskordante Paare werden im übrigen bestätigt durch eine soeben publizierte Studie einer spanischen Forschergruppe.(4) Kürzlich publizierte zudem eine dänische Forschergruppe Daten aus einer nationalen Patientenkohorte. (5) Dabei konnten sie nachweisen, dass die Viruslast nach einer Therapiedauer von sechs Monaten häufig noch nachweisbar ist. Nach 12 Monaten unter Therapie wird die Wahrscheinlichkeit einer nachweisbaren Viruslast aber sehr gering.
Auch bei schwulen Paaren?
Wie gross aber ist das Infektionsrisiko beim Analsex homosexueller Männer? Die schlechte Datenlage bei schwulen Männern war gewichtiger Anlass für Kritik an der EKAF-Position. Eine australische Forschergruppe ging der Frage nach.(6) Die meisten publizierten Untersuchungen zum Übertragungsrisiko bei Männern die Sex mit Männern haben (MSM), stammen aus der Zeit vor Einführung der Kombinationstherapien. Erschwert wird die Untersuchung des Übertragungsrisikos bei schwulen Männern durch verschiedene Faktoren:
- Schwule Partnerschaften sind häufig nicht monogam
- Der HIV-Status der Sexpartner ist oft unbekannt
- Beim Analverkehr wird sowohl die aktive wie auch die passive Rolle übernommen.
Die australische Gruppe untersuchte die Pro-Kontakt-Wahrscheinlichkeit einer HIV-Übertragung beim Analverkehr schwuler Männer bei verfügbarer ART. Im Rahmen der australischen „Health in Men“ – Kohortenstudie wurden 1427 HIV-negative MSM in Sydney während durchschnittlich 4 Jahren beobachtet. Die Teilnehmer wurden alle sechs Monate befragt, persönlich oder telefonisch alternierend, sowie einmal pro Jahr auf HIV getestet.
53 Männer haben sich im Beobachtungszeitraum mit HIV infiziert. Die geschätzte Pro-Kontakt-Wahrscheinlichkeit einer HIV-Übertragung betrug bei ungeschütztem, passivem Analverkehr mit Ejakulation 1.43%, ohne Ejakulation, bzw. in aktiver Stellung war das Risiko etwas weniger als halb so gross (um 0.65%). Diese Risiken erscheinen unerwartet hoch. Was uns die Studie allerdings verschweigt, ist die wichtige Information, ob die infizierten Sexualpartner unter Therapie standen oder nicht. Insgesamt geht man davon aus, dass 70% der HIV-positiven MSM in Sydney therapiert werden.
Mögliche Gründe für das unverändert hohe Übertragungsrisiko sind:
- Risikokontakt während der Primoinfektion (hohe Viruslast, Infektion unerkannt und nicht therapiert)
- Die Prävalenz nicht diagnostizierter HIV-Infektionen könnte höher sein als von den AutorInnen angenommen
- Das Übertragungsrisiko korreliert bei Analverkehr weniger gut mit der Viruslast im Blut als beim Vaginalverkehr
- Die Prävalenz sexuell übertragbarer Krankheiten hat gegenüber der Zeit vor Einführung der ART zugenommen
Unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen bedeuten diese Daten, dass ungeschützter Analverkehr, sowohl aktiv wie auch passiv, nach wie vor ein relativ hohes Übertragungsrisiko darstellt. Das bedeutet aber keineswegs, dass das EKAF Statement zum HIV-Transmissionsrisiko unter HAART auf den Analverkehr nicht anwendbar wäre. (7)
Die Feststellung, dass wir keine sauber dokumentierten Fälle von HIV-Übertragungen unter ART kennen, war die wichtigste Grundlage, die zum EKAF Positionspapier führte. Dies gilt nicht nur auch, sondern vor allem für MSM, denn in dieser Gruppe würden wir die ersten Fälle von Übertragungen unter ART erwarten. Zentral ist ausserdem, dass die Publikation der EKAF 2008 keine Richtlinie, sondern eine Information ist: Die EKAF betrachtet es als wichtig, dass serodiskordante Paare diese Fakten kennen und innerhalb der Partnerschaft selber informiert entscheiden können.
Falsche Panikmache
Die oben erwähnten australischen Daten wurden unter anderem durch die Newsplattform der Canadian Aids and Treatment Information Exchange herangezogen, um die Aussagen der EKAF zu diskreditieren.(7) Die Kanadier ziehen aber die falschen Schlussfolgerungen. Sie schreiben, dass sexuelle HIV-Übertragung von HIV unter MSM bei einer Viruslast von weniger als 50 Kopien/ml bereits mehrfach vorgekommen sei. Dabei wird aber auf Studien verwiesen, deren Autoren nicht validierte und umstrittene Prüfverfahren verwenden. Diese vermögen freie (d.h. infektiöse) HI-Viren und zell-assoziierte (also in Zellen integrierte) Viren nicht sicher zu unterscheiden. Die kanadischen Autoren besprechen also die australische Studie, und übertiteln diese mit Schlussfolgerungen aus anderen Untersuchungen.
Weitere grosse Studien in Vorbereitung
HIV-Übertragungen bei unterdrückter Viruslast wurden zwar vereinzelt dokumentiert, doch aus Einzelfällen dürfen keine Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit abgeleitet werden. Was uns bis heute fehlt, ist eine grosse, randomisierte und kontrollierte Studie unter serodiskordanten heterosexuellen und schwulen Paaren. Derartige Studien sind gegenwärtig in Vorbereitung.*
David H.-U. Haerry
(1) Das-Douglas M et al, “Decreases in Community Viral Load Are Associated with a Reduction in New HIV Diagnoses in San Francisco”, 17th CROI 2010, abstract 33, www.retroconference.org.
(2) „Start HAART as soon as found to be infected - SF Endorses New Policy for Treatment of H.I.V.", New York Times, 2. April 2010.
(3) Donnell D et al. “ART and risk of heterosexual HIV-1 transmission in HIV-1 serodiscordant African couples: a multinational prospective study”, 17th CROI 2010, abstract 136.
(4) Del Romero C et al, „Combined antiretroviral treatment and heterosexual transmission of HIV-1: cross sectional and prospective cohort study“, British Medical Journal, 2010, 340, c2205, doi:10.1136/bmj.c2205.
(5) Engsig FN et al, „Risk of high-level viraemia in HIV-infected patients on successful antiretroviral treatment for more than 6 months“, HIV Medicine, DOI: 10.1111/j.1468-1293.2009.00813.x.
(6) Fengyi Jin et al., AIDS 2010, 24: 907-913
(7) www.catie.ca/catienews.nsf
Besten Dank an Prof. Pietro Vernazza für die Durchsicht des Manuskripts.
Swiss Aids News 2, Juni 2010, www.aids.ch
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Seit das HI-Virus als AIDS-Erreger identifiziert ist, befasst sich die Wissenschaft mit dem Thema „Heilung“von HIV. Bis vor kurzem noch ein Thema für Verwegene, sorgte es an der heurigen Retrovirenkonferenz für die eigentliche Sensation. Ein konkreter Fall einer Heilung von HIV ist mittlerweile etabliert, weitere könnten folgen.
Besagter Berliner Patient war seit 1995 mit HIV infiziert. Im Jahr 2006 erhielt er eine noch schlimmere Diagnose: eine akute Leukämie wurde festgestellt. Der behandelnde Arzt hatte eine sehr gute Idee: eine Knochenmark- (Stammzellen-) transplantation von einem sehr speziellen Spender – einem Spender mit einer Delta-32 Mutation . Damit, spekulierte der Arzt, könnte vielleicht sowohl die Leukämie wie auch HIV geheilt werden. Das Immunsystem des Patienten wurde durch die Chemotherapie zur Behandlung der Leukämie zerstört, und anschliessend über die Knochenmarktransplantation wieder hergestellt.
Eine solche Strategie lässt sich nicht einfach bei anderen Patienten einsetzen. Abgesehen von den Kosten ist der Eingriff auch sehr belastend – der Berliner Patient konnte zeitweise weder gehen noch reden. Der Fall hat aber gezeigt, dass HIV möglicherweise mit einer Gentherapie geheilt werden kann. Wir haben ja bereits ein zugelassenes Medikament, welches den CCR5-Rezeptor blockiert und damit die Virusvermehrung unterdrückt.
Man stellte sich nun die Frage, ob wir bei Menschen mit HIV, welche ja die CCR5-Mutation nicht haben, gentechnisch eine solche herbeiführen könnten. Offenbar ist das möglich, wie eine sogenannte „proof of concept“ – Studie zeigt.
Sechs HIV-positive Männer unter Therapie, ca. 50-jährig, wurden in die Studie aufgenommen. Alle Teilnehmer waren seit 20-30 Jahren HIV-positiv, hatten eine nicht nachweisbare Viruslast und CD4-Zellen zwischen 200 und 500/ml.
Das Vorgehen ist aus der Gentherapie bereits bekannt: den Patienten wurde Blut entnommen, aus diesem wurden T-Helferzellen herausgefiltert, diese T-Zellen wurden im Labor aktiviert und mit sogenannten Zinkfinger-Nukleasen behandelt. Zinkfinger-Nukleasen sind Restriktionsenzyme, welche spezifische DNA-Sequenzen entfernen können. Hier wurden sie benutzt, um den CCR5-Rezeptor zu brechen. Etwas 25% der entnommenen T-Zellen wurde so behandelt. Anschliessend wurden diese Zellen eingefroren, an die Studienklinik zurückgeschickt und den Patienten per Infusion zurückgegeben. Eine Gruppe erhielt 10 Mio Zellen, eine zweite 20 Mio, eine dritte Gruppe mit 30 Mio Zellen ist erst in Behandlung.
Das Ergebnis dieser „Kur“ ist beeindruckend. Es gab kaum Verträglichkeitsprobleme. Einige Patienten hatten grippeähnliche Symptome, diese gingen aber rasch vorbei. Bei allen Teilnehmern wurden die veränderten CD4-Zellen vom Körper aufgenommen und vermehrten sich dort, ganz wie normale CD4-Zellen. Bei 5 von 6 Patienten stieg die Zahl der CD4-Zellen nachhaltig um durchschnittlich 200 Zellen an. Ebenfalls hat sich bei diesen Patienten das Verhältnis der CD4 zu den CD8-Zellen normalisiert – dieses wird normalerweise durch die HIV-Infektion gestört.
Nach 90 Tagen waren bis 7% der CD4-Zellen im periphären Blut und in der Darmschleimhaut CCR5-veränderte Zellen. Die Forscher gehen davon aus, dass dieser Anteil "HIV-resistenter" CD4-Zellen bei den betroffenen Patienten noch zunehmen wird. Wie stark dies langfristig der Fall sein wird, ist aber noch unklar.
Diese Resultate bestätigen grundsätzlich, was wir beim Berliner Patienten gesehen haben. Noch ist damit das Ziel einer heilenden HIV-Therapie noch nicht erreicht.
Es gilt jetzt als nächstes herauszufinden, ob dieses Vorgehen auch bei Patienten mit nicht unterdrückter Viruslast funktioniert, diese reduziert und sich damit ein klinischer Nutzen erzielen lässt. Dieser Versuch wird sowohl mit unbehandelten Patienten wie auch mit „salvage“ Patienten (Leute mit multiresistenten Viren) durchgeführt.
Man hofft also, durch dieses Vorgehen ein Reservoir von HIV-resistenten CD4-Zellen aufbauen zu können, derweil die nicht resistenten Zellen durch das HI-Virus ausradiert würden.
Was ist mit dem zweiten Rezeptor, CXCR4?
HIV kann einen zweiten Rezeptor benutzen, um in die CD4-Zellen einzudringen. Dieser nennt sich CXCR4. Übertragene Viren sind fast immer CCR5-tropisch; bei fortschreitender Schwächung des Immunsystems beobachtet man CXCR4 häufiger.
Die Zinkfinger-Nuklease Technologie wurde auch hier angewandt. Im Tiermodell funktioniert auch das – Resultate mit Patienten müssen wir aber abwarten. In der Praxis könnte die die Blockierung des CXCR4-Rezeptors als schwieriger erweisen. Das Immunsystem der betroffenen Patienten ist weniger fit als bei CCR5-tropischen Menschen.
Wäre dann die Heilung Realität?
Vielleicht. Der Berliner-Patient wurde 3 Jahre nach seiner Behandlung offiziell als von HIV „geheilt“ erklärt. Ebenso möglich ist aber, dass die Gentherapie ab und zu eingesetzt die heutige antiretrovirale Behandlung ablösen könnte. Falls aber die Gentherapie wirklich die Ausmerzung (Eradikation) von HIV ermöglicht, dann wäre dies der bisher grösste Erfolg der Gentherapie in der Medizin. Viele ExpertInnen sind heute überzeugt, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Wann dies der Fall sein wird, und ob dannzumal alle Menschen mit HIV gleichermassen profitieren können, ist gegenwärtig nicht abzuschätzen. Ein Zeithorizont von 10 Jahren für erste "serienmässige" Heilungen könnte aber realistisch sein.
David H.U. Haerry
Lalezari J et al. Successful and persistent engraftment of ZFN-M-R5-D autologous CD4 T Cells (SB-728-T) in aviremic HIV-infected subjects on HAART. 18th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, abstract 46, Boston, 2011.
Wilen C et al. Creating an HIV-resistant immune system: using CXCR4 ZFN to edit the human genome. 18th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, abstract 47, Boston, 2011.
POSITIV 1/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Ein prominentes Thema an der Retrovirenkonferenz in Boston 2011 waren zusätzliche Daten zur Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP).. Neue Daten gab es insbesondere zu Therapietreue, Nebenwirkungen und zum Resistenzbildungsrisiko. Diskutiert wurde auch die Frage einer Zulassung von HIV-Medikamenten für Präventionszwecke durch die us-amerikanische Zulassungsbehörde (FDA).
Therapietreue
Die neuen Daten zur Adhärenz zeigen, dass schwule Männer mit dem höchsten Infektionsrisiko (häufiger ungeschützter Analverkehr) auch die beste Einnahmetreue hatten. Das ist einerseits erfreulich, andererseits vielleicht ein Hinweis, wo PrEP als Intervention erfolgreich sein könnte: bei den sehr gut informierten Leuten in San Francisco und Boston mit dem höchsten Risiko.
An der CROI wurden Medikamentenspiegeldaten publiziert. Von 179 untersuchten Leuten hatten nur 50% Tenofovir und 62% FTC in den Blutzellen . Diese Daten stehen im Widerspruch zur Selbsteinschätzung der Patienten zur eigenen Therapietreue – offenbar habe die meisten Mühe zuzugeben dass sie die Medikamente nicht korrekt einnehmen. Die ingesamt teilweise schlechte Adhärenz muss uns zu denken geben. Im Kontext einer klinischen Studie werden die Teilnehmer optimal betreut und beraten – ein Aufwand, der im Alltag nicht möglich sein wird.
Nebenwirkungen
Eine weitere Studie befasste sich mit der Knochenmarkdichte. Truvada kann diese unter Dauertherapie negativ beeinflussen. Es zeigte sich nun, dass die iPrex Studienteilnehmer schon beim Eintritt in die Studie häufig eine erniedrigte Knochenmarkdichte hatten (möglicherweise eine Folge von Poppers und Amphetaminen). Während der Studie sank die Knochenmarkdichte weiter ab, Osteoporose wurde aber nicht festgestellt. Aber die Beobachtungszeit (1 ½ - 2 Jahre) war kurz, und die Adhärenz nicht immer gut. Gut möglich, dass bei längerer Anwendung die Häufigkeit von Knochenbrüchen zunehmen würde.
Resistenzen
Zur Bildung von Resistenzen: es zeigte sich, erfreulicherweise, dass die Probanden welche sich mit HIV infizierten, keine Resistenzen aufwiesen – Truvada als Therapie also nach wie vor einsetzbar ist.
Zulassung von HIV-Medikamenten für die Prävention?
Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA wird sich in den kommenden Monaten mit der Zulassung von Truvada für die PrEP befassen. Das FDA wird also entscheiden müssen, bei welcher Bevölkerungsgruppe die Risiko-Nutzenbilanz positiv ist. Das FDA wird sich aber nicht mit der Preisfrage oder der Finanzierung von PrEP beschäftigen. In der Schweiz würde bei heutigem Preisniveau eine Dauertherapie mit Truvada 1'000 Franken pro Monat kosten – für die HIV-Prävention. Es ist davon auszugehen, dass dafür keine Krankenkasse aufkommen wird.
Mir war die PrEP Euphorie an der CROI etwas zu gross. Wir müssen uns sehr gut überlegen, wie wir diese Präventionsstrategie in der Praxis implementieren, und wie die Leute, die das Medikament zu Präventionszwecken nehmen beraten und betreut werden müssen. Es ist ja gut zu wissen, dass eine solche Intervention funktionieren kann. Ich hätte aber lieber ein Medikament, das man nicht dauernd einnehmen muss, sondern bloss davor oder danach, sowie eines, welches in der Therapie von HIV-positiven Patienten eine weniger wichtige Rolle spielt als Truvada. Vielleicht wären die schwulen Hochrisikomänner ja bereit, sowas aus dem Taschengeld selber zu zahlen – das Viagra zahlen sie schliesslich auch selber.
David H.U. Haerry
Truvada ist eine Kombipille aus Tenofovir und FTC
POSITIV 1/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
HIV nimmt insgesamt in der Schweiz seit längerem ab. Aber in bestimmten Gruppen ist die Infektion immer noch stark verbreitet. Warum gibt es solche Unterschiede, und wie kann man dieser Art von Epidemie wirkungsvoll begegnen?
Wenn man sich die HIV-Epidemie der letzten 20 Jahre in der Schweiz anschaut, dann bekommt man auf den ersten Blick ein klares Bild: Nach dem Ausbruch von HIV in der ersten Hälfte der 1980er Jahre stieg die Zahl der HIV-Diagnosen steil an bis auf die beachtliche Zahl von über 3'000 neuen Diagnosen um 1990. Es folgten 10 Jahre in denen die Neudiagnosen wieder stark und stetig sanken, bis zum Tiefpunkt um 2001 von weniger als 600. Es folgte ein leichter Anstieg und eine Plafonierung bei gut 700 Neudiagnosen jährlich, bis um 2008 die Gesamtzahl wieder zu sinken begann. Heute liegt sie bereits wieder beim Niveau von 2001.
Um 600 Neudiagnosen pro Jahr in der Schweiz - das ist eigentlich nicht viel. Ist HIV in der Schweiz also zu einer seltenen Infektionskrankheit geworden. Ja und Nein!
Konzentrierte Epidemien
HIV ist in der heterosexuellen Bevölkerung tatsächlich zu einer seltenen Infektion geworden ist. Deutlich weniger als ein halbes Promille der Heterosexuellen in der Schweiz, sind von HIV betroffen. Man sagt, die "Prävalenz" von HIV betrage in dieser Gruppe <0,5 Promille. Aber in anderen Gruppen ist das nicht so.
Bei schwulen Männern beträgt die Prävalenz um 10%, je nach Region (v.a. in den städtischen Zentren) ist sie noch deutlich höher. Und auch bei Menschen aus Ländern mit hoher HIV-Prävalenz (vor allem Subsahara-Afrika) liegt die HIV-Prävalenz weit über dem Wert der Schweizer Heterosexuellen, teilweise über dem Wert bei schwulen Männern. Man nennt diese Art von Epidemie, die sich nur in bestimmten Gruppen ausbreitet, "konzentriert". Warum gibt es eigentlich konzentrierte Epidemien? Und welche wirkungsvollen und sinnvollen Massnahmen gibt es zur Verbesserung dieser Situation?
Die Epidemie macht, was sie will
HIV wird in der Schweiz fast nur noch auf sexuellem Weg übertragen. Aber die Wahrscheinlichkeit, einem Menschen mit HIV zu begegnen, ist in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen extrem ungleich verteilt! In der Schweiz leben ungefähr 5 Mio. erwachsene, also sexuell aktive Menschen. Man schätzt (weiss das aber nicht genau), dass davon etwa 3% schwule Männer sind - also um 150'000 Personen. Es gibt also etwa 35 mal mehr heterosexuelle als homosexuelle Menschen. Das ist für den Verlauf einer Epidemie enorm wichtig. Je kleiner eine Gruppe ist und je höher in ihr die Prävalenz einer sexuell übertragbaren Infektion (STI), desto höher ist das Risiko, auf einen Menschen mit dieser STI, z.B. mit HIV, zu treffen. Denn es gibt in dieser Gruppe nicht nur viel mehr HIV-positive Menschen, die Auswahl an Sexualpartnern ist auch kleiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit HIV und häufiger wechselnden Partnern sich in dieser Gruppe begegnen, ist dadurch viel grösser. Schwule Männer in einem städtischen Zentrum in der Schweiz müssen davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr neuer Partner HIV-positiv ist, etwa 200 mal grösser ist, als unter heterosexuellen Personen. Dieser Unterschied wirkt sich direkt auf den Verlauf einer Epidemie in einer bestimmten Gruppe aus. Und je weiter eine STI verbreitet ist, umso stärker wirkt diese Dynamik.
Unter solchen Umständen nützt es entsprechend weniger, wenn sich Menschen in einer stark betroffenen Gruppe durchschnittlich viel besser vor HIV schützen. Oder anders gesagt: das durchschnittliche Schutzniveau (das in der Gruppe homosexueller Männer viel höher ist als bei Heterosexuellen gleichen Alters) hat viel weniger Auswirkungen auf den Verlauf einer Epidemie als die Tatsache, dass so viele Mitglieder einer sozialen Gruppe bereits HIV-positiv sind!
Das ist doppelt tragisch für Menschen in diesen stark von HIV betroffenen Gruppen. Nicht nur nützt es nicht so viel, dass sie sich durchschnittlich gut schützen. Sie werden von anderen gesellschaftlichen Gruppen auch noch stigmatisiert dafür, dass die Epidemie unter ihnen tut was sie will.
Was kann man machen?
Safer Sex ist sehr wichtig! Und die HIV-Therapie ist sehr wichtig! Beide Faktoren haben starke Auswirkungen auf den Verlauf der HIV-Epidemie, denn beide Faktoren verhindern, wenn sie voll wirksam sind, HIV-Übertragungen zuverlässig. Den Effekt der HIV-Therapei sieht man übrigens auch in der Schweizer Epidemie deutlich: mit dem Einsatz antiretroviraler Wirkstoffe Ende der 1980er Jahre begann der Rückgang der Epidemie.
Dennoch schützen sich nie alle Menschen perfekt und andauernd, und auch eine HIV-Therapie nehmen noch lange nicht alle. Wir leben in Freiheit und es ist nicht möglich, und soll auch nicht sein, dass man einzelne Menschen zu Safer Sex oder einer HIV-Therapie zwingen kann. Wir wissen übrigens sehr gut, dass solche Zwangsmasnahmen gerade den gegenteiligen Effekt haben. Vulnerable Menschen haben in einem repressiven System viel mehr Angst - sie verstecken sich deshalb und sind für das Präventions- und Medizinsystem nicht mehr erreichbar. Es ist also in jeder Hinsicht richtig, auf Freiwilligkeit zu setzen.
Damit Freiwilligkeit funktioniert, müssen Menschen erstens ihre Schutzoptionen möglichst gut kennen, und sie müssen sie persönlich anwenden können und wollen. Diese Kompetenzen haben AHS und BAG mit ihren Kampagnen und ihrem Beratungssystem in den letzten 20 Jahren erfolgreich gefördert und sie tun es weiterhin.
Wichtig ist ausserdem, dass Menschen ihre HIV-Risiken möglichst gut kennen. Dazu gehört die Sensibilität für die Tatsache, dass man möglicherweise in einer sozialen Gruppe lebt, die weit überdurchschnittlich von HIV betroffen ist. Dieses Bewusstsein ist nicht nur für das Schutzverhalten wichtig, es ist auch der Solidarität in einer Gruppe zuträglich. Besonders unter Menschen aus der Region Subsahara-Afrika ist die Solidarität mit Betroffenen immer noch eine Herausforderung - ebenso wie das Bewusstsein, dass sehr viele Menschen der eigenen Gruppe von HIV betroffen sind. Dieses Bild in den Köpfen zu verändern könnte Gutes bewirken. Und zwar sowohl für HIV-Negative (die dadurch ihre Risiken besser erkennen würden), als auch für HIV-Positive (die durch die grössere Sensibilität für das Thema in ihrer Gruppe mehr Solidarität erwarten könnten).
Rainer Kamber, Aids-Hilfe Schweiz
POSITIV 1/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Die Entwicklung der eigenen Identität und Autonomie in der Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt verlangt jungen Menschen viel ab. HIV-positive Jugendliche müssen sich darüber hinaus mit ihrer Krankheit auseinandersetzen. Bei gesunden Jugendlichen stellt sich die Frage der eigenen Lebenserwartung und zukünftigen Lebensqualität nicht – HIV-positive Adoleszente leben diesbezüglich mit einer existentiellen Unsicherheit. Zudem müssen sie die regelmässige Medikamenteneinnahme und die ärztlichen Kontrollen in ihr selbständiges Leben integrieren.
Wie gehen junge Menschen mit dieser Situation um? Verstehen sie ihre Infektion und können sie mit anderen Menschen in der Familie und im Freundeskreis darüber sprechen? Wie leicht oder wie schwer fällt ihnen die Medikamenteneinnahme? Dies waren die Fragen, die im Mittelpunkt der qualitativen Interviews standen. In sechs Zentren der Schweizerischen Mutter und Kind HIV-Kohorte, die ein Teil der Schweizerischen HIV-Kohorte (SHCS) ist, befragte ein Forschungsteam insgesamt 29 Adoleszente (darunter 7 Knaben und junge Männer) im Alter zwischen 12 und 20 Jahren.
Verständnis der HIV-Infektion
„Meine Eltern nennen die CD4-Zellen ‚kleine Soldaten‘, aber ehrlich gesagt, verstehe ich nicht wirklich, was sie meinen, wenn sie sagen, alles sei in Ordnung“ berichtete ein 14jähriges Mädchen. Diese Aussage war repräsentativ für die Jüngeren unter den Befragten (unter 16 Jahren). Zwar wussten sie, dass die Infektion ansteckend war und Blut eine Rolle spielte – aber keine der jüngeren Jugendlichen konnte erklären, was eine HIV-Infektion eigentlich ist. Sie verstanden ihre Krankheit als eine Art Schicksal. Die meisten älteren Jugendlichen hingegen schienen eine genaue Vorstellung der Bedeutung der Infektion und der Implikationen für ihr Leben zu haben und verstanden auch, wie und dass sie von ihrer HIV-positiven Mutter infiziert wurden. Einige Ältere allerdings wehrten die Tatsache, dass sie infiziert waren, ab. So sagte eine 19jährige junge Frau: „Keine Bedeutung für mich… es ist, wie wenn ich nichts hätte… Nun, eigentlich habe ich auch nichts.“
Fehlende Gespräche
Die wenigsten Jugendlichen haben je darüber sprechen können, wie sie infiziert wurden. Nur ein Kind lebte mit beiden biologischen Eltern; rund zehn Mütter waren an Aids gestorben und sechs Kinder waren adoptiert. Vor allem jene, die alleine mit ihrer HIV-positiven Mutter lebten, berichteten, wie schwer es für sie sei, zuhause über ihre Infektion zu sprechen. Ein 15jähriges Mädchen sagte: „Ich will das nicht mit ihr besprechen, weil ich sehe, wie es ihr wehtut … Sie ist oft in Tränen ausgebrochen und hat gefragt ‚Warum nur habe ich Dir diese Krankheit gegeben‘“. Auch im Freundeskreis sprachen die meisten nicht über ihre Infektion, die Medikamente nahmen sie meist im Geheimen ein. Ärzte und Ärztinnen sollten, so folgerten die Forscher, ihre jungen Patienten auf diese Schwierigkeiten ansprechen und den Rahmen für Familiengespräche bieten. Trauer, Schuldgefühle und Ängste dürften im Beisein medizinischer Fachpersonen und im professionellen Raum einfacher auszudrücken sein.
Therapietreue
Die Ärzte und Ärztinnen von dreiviertel der befragten Jugendlichen schätzten deren Therapietreue als sehr hoch ein. Die jüngeren Patienten waren allerdings auf Erwachsene angewiesen, um sich an die Medikamenteneinnahme zu erinnern. Je älter die Jugendlichen waren, desto eher entwickelten sie eigene Strategien, um die Medikamente regelmässig einzunehmen: Einnahme morgens gleich nach dem Aufstehen, Post-It Kleber am Spiegel oder Handy-Signale. Die graduelle Übernahme der Verantwortung für die richtige Einnahme der Medikamente gehört zum Prozess der zunehmenden Autonomie in der Pubertät. Aber der Schritt in die selbständige und regelmässige Medikamenteneinnahme war für manche junge HIV-Patienten nicht problemlos, was mit der mangelnden Vorbereitung und fehlenden Gesprächsmöglichkeiten zusammenhängen könnte.
Auch die Beziehung zur medizinischen Betreuungsperson spielte eine wichtige Rolle. Wenn Jugendliche ihrer Ärztin/ihrem Arzt Schwierigkeiten bei der Einnahme eingestehen und eigene Vorstellungen einbringen und vorschlagen konnten, war die Therapietreue besser. Im Gegensatz dazu führte eine paternalistische Haltung der medizinischen Fachpersonen dazu, dass Jugendliche Schwierigkeiten verschwiegen und keine eigenen Strategien zur Einnahme entwickeln konnten.
Qualitative Studien sind zwar häufig nicht repräsentativ, sie können aber einen vertieften Einblick in ein Problem bieten und das Verständnis für Zusammenhänge wecken. Die Forschungsgruppe der vorliegenden Studie hat aus den Gesprächen praktische Empfehlungen abgeleitet: Medizinische Fachpersonen sollten erstens offene Gesprächssituationen mit der Familie ermöglichen und dabei auch schwierige Themen nicht meiden, sie sollten zweitens ältere Jugendliche auf ihre Therapietreue ansprechen und deren Eigeninitiative fördern und drittens das Phänomen der Rebellion und Verweigerung wahrnehmen, welches bei manchen Jugendlichen verhindert, HIV als Teil ihres Lebens zu akzeptieren.
Text: Shelley Berlowitz
P.-A. Michaud et al.: Coping with an HIV infection. A multicenter qualitative survey on HIV positive adolescents’ perceptions of their disease, therapeutic adherence and treatment, Swiss Medical Weekly 2010;140 (17 – 18);247–253
POSITIV 2/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
Seite 10 von 11