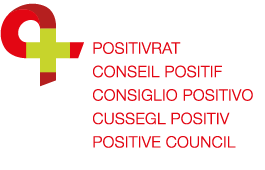Aktuell
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Das ist das traurige Fazit, gezeigt am Modell mit Daten der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie, das kürzlich am Infektiologenkongress CROI 2015 grosses Aufsehen erregte. Mit HIV und Hepatitis C koinfizierte Menschen, welche eine Therapie der Hepatitis C verzögern, haben ein erhöhtes Risiko für Leberversagen, Leberkrebs oder Tod aufgrund eines Leberschadens. Wird die Hepatitis C erst behandelt, wenn sich eine Leberzirrhose entwickelt hat, erhöht sich das Risiko für einen Tod aufgrund Leberschäden um das Fünffache. Und die Patienten sind bis zu viermal länger ansteckend. Angesichts dieser Daten sind die in der Schweiz verordneten Limitationen beim Einsatz der neuen Hepatitis-C-Therapien unverantwortlich und unhaltbar.
Eine Hepatitis–C-Infektion (HCV), die nicht spontan geheilt wird und chronisch wird, kann zu fortgeschrittenen Lebererkrankungen mit Diagnosen wie Leberzirrhose, hepatozellulären Karzinomen (Leberkrebs) und – im Endstadium – zu akutem Leberversagen führen. Meist dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis sich diese Krankheiten entwickeln. Bei mit HIV koinfizierten Menschen schreitet die Krankheitsentwickelung rascher fort als bei HCV-monoinfizierten Patienten. Die beiden Infektionen begünstigen sich gegenseitig. Eine erfolgreiche, rasche Hepatitis C Therapie eliminiert diese Risiken nicht völlig, aber reduziert sie deutlich.
Die bisherigen, auf Interferon basierenden HCV-Therapien wurden oft sehr schlecht vertragen, dauerten bis zu einem Jahr und waren nur in der Hälfte aller mit HCV Genotyp 1 infizierten Patienten erfolgreich. Angesichts dieser Tatsachen empfahlen die massgebenden Therapierichtlinien eine Behandlung hinauszuzögern, bis eine fortgeschrittene Lebererkrankung nachgewiesen war. Weil jetzt viel wirksamere und besser verträgliche Therapien vorhanden sind, fordern Ärzte und Patientenvertreter einen Paradigmenwechsel – alle Patienten mit einer chronischen Hepatitis C sollten so rasch wie möglich behandelt werden. Ein Modell zeigt nun, dass dies medizinisch sinnvoll ist. In der Schweiz und auch anderswo haben die hohen Kosten der Medikamente jedoch dazu geführt, dass die zuständigen Behörden die Therapie auf Patienten mit einer fortgeschrittenen Erkrankung beschränkten.
Modell mit Kohortendaten
Cindy Zahnd von der Universität Bern und ihre Kollegen von der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie entwickelten ein mathematisches Modell, welches den Einfluss verschiedener HCV-Therapiestrategien auf das Fortschreiten der Leberfibrose bei mit HIV koinfizierten HCV-Patienten untersucht. Das Modell arbeitet mit Daten neu diagnostizierter HCV-Infektionen unter schwulen und bisexuellen Männern in der HIV-Kohortenstudie. Alle Kohorten-Patienten werden jährlich auf HCV-Antikörper und erhöhte Leberenzyme überprüft. Das Modell berücksichtigt Patienten aus allen Stadien ab akuter HCV-Infektion über „keine Fibrose“, Stadium F0; „leichte Fibrose“ F1; „moderate Fibrose“ F2; „schwere oder fortgeschrittene Fibrose“ F3 oder Leberzirrhose F4 wie auch dekompensierende Leber (Leberversagen), Leberkrebs und Tod. Die Forscher setzten voraus, dass das Alter der Patienten beim Zeitpunkt der Infektion und Alkoholkonsum den Krankheitsverlauf beeinflussen.
Das Modell geht weiter davon aus, dass im ursprünglichen Szenario mit den alten Therapien 60% der Patienten mit pegyliertem Interferon und Ribavirin behandelt wurden und diese Therapie bei 40% der Patienten erfolgreich war. Bei den neuen, interferonfreien Therapien ging man von Behandlungsraten von 100% aus, welche in 90% aller Fälle erfolgreich verläuft. Die Risiken von Lebererkrankungen und Tod wurden bewertet, wie auch die Dauer der Infektiosität (definiert als nachweisbare Hepatitis-C-Viruslast). Diese Szenarien wurden verglichen mit verschiedenen Therapiestrategien – Behandlung innert eines Monats nach Diagnose (was nicht dem Zeitpunkt der Ansteckung entspricht), ein Jahr nach der Diagnose oder bei Lebererkrankungsstadium F2, F3 oder F4. Das Risiko einer HCV-Reinfektion nach erfolgreicher Therapie wurde nicht berücksichtigt.
Frühe Therapien verhindern Todesfälle…
Im Ausgangsszenarium (Interferon-basierende Therapien) entwickelten ungefähr 10% der Patienten eine dekompensierende Leber, mehr als 15% entwickelten ein Leberkarzinom und mehr als 25% starben an leberbedingten Komplikationen. Mit den neuen Therapien und einer raschen Behandlung innerhalb eines Monats oder einem Jahr nach Diagnose werden die Proportionen dramatisch reduziert – nur etwa 1% der Patienten entwickeln eine dekompensierende Leber, nur etwa 2% ein Leberkarzinom und nur ca. 3% sterben an leberbedingten Komplikationen.
…und Neuansteckungen
Wird der Therapiebeginn auf die Lebererkrankungsstadien F2 oder F3 verzögert, steigen die Risiken von Lebererkrankungen und Todesfall an. Ein steiler Anstieg der Risiken zeigt sich bei einer Therapieverzögerung auf das Stadium F4. Bei Behandlungsbeginn im Stadium F3 zeigen 3% der Patienten eine dekompensierende Leber, die Leberkrebsrate steigt auf 8% und leberbedingte Todesfälle betragen 10%. Bei Therapiebeginn im Stadium F4 verschlechtern sich diese Werte auf 5%, 20% und 25%. Wird die Therapie von F2 auf F3 verschoben, verdoppelt sich die Rate von leberbedingten Todesfällen von 5% auf 10%; verschiebt man die Therapie auf F4, verfünffacht sich das Risiko auf 25%.
Innerhalb eines Monats bis einem Jahr behandelte Patienten können HCV im Durchschnitt während ca. 5 Jahren übertragen. Setzt die Behandlung bei F2 ein, sind sie während 12 Jahren infektiös, mehr als 15 Jahre bei F3 und fast 20 Jahre bei einer Therapie im Stadium F4. Cindy Zahnd betonte, dass zwischen den raschen Behandlungsstrategien innerhalb eines Monats oder einem Jahr nach Diagnose kaum ein Unterschied festzumachen ist. Behandlungsverzögerungen in die Stadien F2, F3 oder F4 jedoch machen wirklich etwas aus.
Trotz Heilung: Risiko Leberkrebs erhöht
Das Risiko einer dekompensierenden Leber, Leberkrebs oder leberbedingtem Tod sinkt auch bei erfolgter Heilung nicht auf Null. Diese Risiken steigen bei verzögerter Therapie zudem stark an. Die Mehrheit der leberbedingten Todesfälle findet nach erfolgter Heilung statt, wenn der Therapiebeginn auf die Stadien F3 oder F4 verzögert wird.
Der an der Studie beteiligte Hansjakob Furrer vom Inselspital in Bern betonte denn auch nach der Präsentation von Cindy Zahnd dass die Studie aus genau diesem Grund durchgeführt wurde. „Wir verwenden die Daten für Gespräche mit dem BAG. Diese Verhandlungen werden durch die klare Datenlage erleichtert – alles spricht für eine frühere Behandlung der HCV Patienten“.
Die gegenwärtig verfügten Limitationen des Bundesamtes für Gesundheit verzögern die Behandlung auf F3 oder F4, mit nur wenigen Ausnahmen. Die Alarmglocken läuten – wir hoffen, sie werden gehört. Menschen mit HIV Ko-Infektionen sollten sofort von Therapien profitieren können. Zudem: Eine rechtzeitige Therapie der Patienten führt zu einer Volumenausweitung. Unter dieser Voraussetzung sollten die Behörden Preisreduktionen mit den Herstellerfirmen aushandeln können. Andere Länder machen das vor. Aus Public-Health- und aus der Patienten-Perspektive ist die gegenwärtige Situation unhaltbar.
Zahnd C et al. Impact of deferring HCV treatment on liver-related events in HIV+ patients. 2015 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Seattle, abstract 150, 2015; http://www.croiconference.org/sessions/impact-deferring-hcv-treatment-liver-related-events-hiv-patients
Autor: David Haerry
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Sie sind HIV positiv?
Dann helfen Sie uns, mehr über Ihre Betreuung und die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Behandlungsteam zu erfahren. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit für eine anonyme Online-Umfrage. Die Umfrage ist auf deutsch, englisch, französisch, spanisch, portugiesisch, italienisch und russisch verfügbar.
https://www.research.net/s/Shaping_my_care
Es handelt sich um eine europaweite Umfrage, unterstützt durch einen Fortbildungszuschuss von Gilead Sciences.
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Die englische und die französische Prä-Expositions Prophylaxe (PrEP) Studien PROUD und iPERGAY zeigen das gleiche Bild: der Einsatz von Truvada in der richtigen Zielgruppe verhindert 4 von 5 möglichen HIV-Infektionen bei Männern die Sex mit Männern haben. Der Positivrat unterstützt das Anliegen der europäischen Gruppen voll und ganz.
Richtig eingesetzt ist die Intervention aus der Public Health Perspektive effizient. Wir fordern von Gilead sich um eine Indikationserweiterung bei Swissmedic zu bemühen und die zuständigen Behörden um eine Definition der anspruchsberechtigten Zielgruppen und Regelung der Kostenübernahme sowie einen Aktionsplan für die Implementierung.
Europe_needs_the_HIV_prevention_pill_now_24_2__17_30_CET.pdf
Pharmacovigilance – Meldung vermuteter unerwünschter Arzneimittelwirkungen: ein Memo für die Praxis.
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Wozu melden?
Indem PatientInnen allfällige ungewöhnliche Reaktionen auf ein Medikament an ihren behandelnden Arzt oder Ärztin melden, können sie gemeinsam mit den Fachleuten zur Sicherheit der Medikamente und zu ihrem sicheren Gebrauch beitragen. Die Fachleute wiederum erhalten zu jedem Bericht über eine vermutete unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) eine aktuelle Rückmeldung, und oft auch einen therapeutischen Rat, der wiederum den PatientInnen zugute kommt.
Was melden?
Neue (nicht oder ungenügend in der Arzneimittelinformation erwähnte oder schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Gemäss Heilmittelgesetz sind ÄrztInnen und ApothekerInnen seit 2002 zu deren Meldung verpflichtet. Ebenfalls zur Meldung von solchen UAW verpflichtet sind die Zulassungsinhaberinnen. Die PatientInnen haben ein Melderecht.
Als schwerwiegend gelten folgende UAW:
- sie führen zur Hospitalisation oder verlängern diese,
- führen zu einem schweren oder bleibenden Schaden, sind lebensbedrohend oder enden tödlich,
- sind sonst medizinisch wichtig (Beispiele: Hypoglykämie mit Bewusstseinsstörung oder epileptischer Anfall, die ambulant behandelt werden).
Der Verdacht auf eine Verursachung durch das Medikament reicht aus. Der Beweis soll nicht abgewartet werden.
Wie melden?
Am besten umgehend den/die behandelnde/n Arzt/Ärztin informieren. Diese Fachpersonen können anschliessend ihre Meldung über das neue elektronische Meldeportal ElViS erstatten.
Der Zugriff auf dieses Meldeportal erfolgt über die Swissmedic Homepage www.swissmedic.ch:
- Marktüberwachung
- Meldung von unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln
Mehr zum Thema
Auf www.swissmedic.ch
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Diese Nachricht hat die Debatte um das „chemische Kondom“ weltweit neu entfacht: Ein beratendes Gremium der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA empfiehlt die Zulassung des HIV-Medikamentes Truvada als Prä-Expositionsprophylaxe.
Das Antiviral Drugs Advisory Committee (ADAC) der FDA empfiehlt die Zulassung von Truvada als Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) für schwule Männer mit 19 gegen 3 Stimmen, und mit 19 gegen 2 für die Benutzung in serodiskordanten Beziehungen. Mit einer dritten Abstimung empfiehlt das ADAC mit 12 gegen 8 Stimmen, Truvada für den generellen Gebrauch für alle Menschen mit hohem HIV-Risiko zuzulassen. Das FDA muss den Empfehlungen dieses beratenden Gremiums nicht Folge leisten. Eine definitive Entscheidung wird per 15. Juni erwartet. Ein Entscheid gegen die Empfehlung des ADAC ist aber angesichts der dortigen Stimmenverhältnisse sehr unwahrscheinlich.
Jubel und Kritik
PrEP hat die Gemüter schon immer erregt. Das zeigt sich jetzt erneut. Die Reaktionen reichen von Hurrageschrei über Sorgenfalten bis zu Verständnislosigkeit. Bereits die Studien wurden seinerzeit massiv kritisiert und teilweise sogar abgebrochen. Die damalige Kritik war zum Teil berechtigt, aber stark übertrieben – sie hat letztlich einfach die Forschung verzögert. Es war nicht einfach, Präventionsstudien mit antiretroviralen Medikamenten in Ländern durchzuführen, wo nicht alle HIV-Patienten Zugang zu einer Therapie haben. Wegen der hohen Zahl von Neuinfektionen in genau diesen Ländern meinten die Sponsoren aber sie hätten eine moralische Pflicht, Präventionsstudien durchzuführen. Auch darüber kann man sich streiten.
Das ADAC beruft sich auf Daten, die seit dem 23. November 2010 öffentlich sind. Die damalige Eidgenössische Kommission für Aidsfragen EKAF hat sich gleichentags wie folgt vernehmen lassen:
„Die Eidg. Kommission für AIDS Fragen (EKAF) hat am 24.11.10 die Studienresultate (Grant et al, NEJM 23.11.10, online) der ersten Publikation zur Wirksamkeit einer täglich eingenommen HIV-Zweierkombination (PrEP) zur Prävention der HIV-Infektion gemeinsam mit Experten der Fachkommission Klinik und Therapie HIV/AIDS diskutiert und gewürdigt.
Die Kommissionen kommen zum Schluss, dass die mässige Wirksamkeit der hier untersuchten Dauerbehandlung zur PrEP keine Änderung der Präventionsstrategie notwendig macht. Die Nebenwirkungen, der hohe Preis und das Risiko der Entstehung von resistenten HIV-Stämmen stehen in keinem Verhältnis zum mässigen Nutzen der Behandlung.“
Die Therapietreue macht den Unterschied
Seit November 2010 ist aber in der HIV-Präventionsforschung einiges passiert, und die vielen zum Teil widersprüchlichen Erkenntnisse sind mit ein Grund für die erneuten Diskussionen. Verschiedene PrEP Studien haben in den letzten 18 Monaten widersprüchliche Daten publiziert – iPREX, FEM-PrEP, Partners PrEP und TDF2 zeigten eine Wirksamkeit von 0 (FEM-PrEP) bis 83% (für Männer in Partners PrEP). Nachfolgende Analysen zeigten, dass diese Resultate durch unterschiedliche Adhärenz bedingt sind. In der iPREX Studien war die Wirksamkeit von PrEP 92% bei jenen Studienteilnehmern, welche nachweisbare Medikamentenspiegel im Blut hatten. Damit ist klar, dass die Adhärenz für die Wirksamkeit von PrEP eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber eigentlich ist das ja eine Binsenwahrheit. Wo Pillen nicht genommen werden, können sie nicht wirken...
Das liebe Geld
Man macht sich auch Sorgen wegen der Kosten. Die Monatspackung Truvada kostet in der Schweiz Fr. 1'029.90. Wer kann sich das leisten? Was meinen die Krankenkassen, das zuständige Bundesamt? Man wird sich auch in der Schweiz mit dieser Frage noch befassen müssen. Eine HIV-Infektion verursacht Kosten von ca. einer Million Franken. Wenn eine Person eine wilde Phase von zwei, drei Jahren hat und sich nicht auf Kondome verlassen kann, könnte sich die Investition wohl lohnen. In den Entwicklungsländern sieht die Rechnung anders aus – es würden deutlich billigere generische Versionen eingesetzt.
Bis jetzt wurde die Wirkung von PrEP nur in Studien mit täglicher Dosierung untersucht. IPERGAY in Frankreich untersucht die Wirkung von Truvada wenn das Medikament bloss vor und nach dem Sex eingenommen wird. Falls diese Strategie funktioniert, reduzieren sich die Kosten deutlich. Allerdings sei hier gleich bemerkt, dass es auch bei einem solchen sogenannt intermittierenden Einsatz mit der Adhärenz nicht einfach wird.
Gibt es Alternativen?
Von grossem Interesse wäre auch die Verwendung anderer Substanzen. Truvada ist eines der meistverwendeten Medikamente in der HIV-Therapie. Truvada hat bekannte Nebenwirkungen im Dauergebrauch, und die Gefahr von Resistenzbildungen ist auch nicht zu unterschätzen. Sehr gerne wüsste man, ob sich besser verträgliche Substanzen bei intermittierender Abgabe bewähren würden – offensichtliche Kandidaten sind CCR5-Inhibitoren wie Maraviroc oder Integraseinhibitoren wie Raltegravir. Raltegravir könnte unter Umständen auch als Pille danach wirken. Viele gute Argumente und intensives Lobbying haben aber bisher nichts gefruchtet.
Voläufiges Fazit
Halten wir also fest:
- Das FDA wird Truvada als PrEP für bestimmte Risikogruppen sehr wahrscheinlich zulassen.
- Die europäischen Behörden beschäftigen sich mit dem Thema, aber eine rasche Zulassung - und insbesondere: eine Kostenübernahme durch europäische Gesundheitssysteme - ist vorderhand nicht zu erwarten.
- Intermittierende PrEP Studien müssen gemacht werden, und es ist zu hoffen, dass IPERGAY nach einer Vorbereitungsphase auch in die Schweiz kommt.
- Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Partybuben unter den Schweizer MSM ab morgen Truvada mit Viagra kombiniert einwerfen.
- Man wird sich in der Schweiz erneut ohne Scheuklappen mit dem Thema PrEP befassen müssen.
Seite 7 von 11