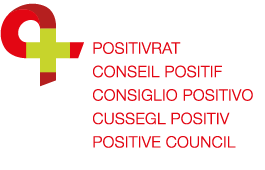Aktuell
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Alle modernen HCV-Therapien trumpfen mit Heilungsraten von über 95% für die Genotypen 1 und 4 auf. Man darf sich deshalb fragen, ob überhaupt weitere und nochmals verbesserte HCV-Therapien entwickelt werden sollen. Am Kongress wurden verschiedene Doppel- und Dreifachkombinationen vorgestellt und diskutiert. Einige Moleküle sind in der Entwicklung bereits weit fortgeschritten, andere noch in einem frühen Stadium. Sie versprechen weitere Fortschritte unabhängig vom Genotyp, insbesondere auch für Genotyp 3; höhere Resistenzbarrieren und nochmals eine kürzere Therapiedauer.
An dieser Stelle war ein längerer Artikel über die wichtigsten News vom AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) in San Francisco vom November geplant. Weil bereits nächste Woche in Boston die Retrovirus Konferenz CROI stattfindet und wir von dort berichten werden, beschränken wir uns hier auf das Allerwichtigste in Stichworten. Von der CROI erwarten wir neue Daten im Bereich der HIV/HCV-ko-infizierten Patienten.
- 8 Wochen Therapie mit Sofosbuvir und Ledipasvir zeigt bei Patienten mit Genotyp 1 sehr guten Erfolg. Kürzere Therapiezyklen von 8 Wochen sollten weiter untersucht werden, besonders weil Patienten in naher Zukunft ohne Fibrosesymptome behandelt werden dürften.
- Die Heilungsraten für alle direkt aktiven Substanzen (directly active agents DAA; 2 DAA Substanzen, mit oder ohne Ribavirin) bleiben sehr hoch. Auch im Alltag werden mehr als 90% der Patienten definitiv geheilt. Patienten mit Zirrhose, niedrigen Thrombozyten (Blutplättchen), männlichem Geschlecht und mit Therapien, welche nicht den Richtlinien entsprechen, haben ein höheres Risiko für ein Therapieversagen.
- Beim gegenwärtig nur schwer therapierbaren Genotyp 3 führt die Zugabe von Ribavirin zu Daclatasvir und Sofosbuvir für 12 oder 16 Wochen zu stark verbesserten Ansprechraten innert 12 Wochen bei Patienten mit fortgeschrittener Fibrose oder dekompensierter Zirrhose. Eventuell führt eine Behandlung über 24 Wochen zu noch besseren Heilungsraten (diese Frage ist noch offen).
- Die kurz vor der behördlichen Zulassung stehende Kombination von Elbasvir & Gazoprevir zeigt bei Patienten mit Genotypen 1, 4 und 6 sowie ko-infizierten Patienten sehr gute Heilungsraten. Die Kombination erweist sich auch als sicher bei Patienten unter Drogensubstitutionstherapie.
- Die Kombination Sofosbuvir / Velpatasvir während 12 Wochen wird gut vertragen und führt zu hohen Heilungsraten bei therapienaiven und therapieerfahrenen Patienten mit Genotyp 1, 2, 4, 5 und 6, mit und ohne Zirrhose. Dieselbe Kombination zeigt innert ebenfalls 12 Wochen bessere Resultate bei Genotyp 3 als 24 Wochen Sofosbuvir & Ribavirin.
- Patienten mit dekompensierter Zirrhose sind besonders schwierig zu behandeln. Sofosbuvir / Velpatasvir plus Ribavirin während 12 Wochen führt zu hohen Ansprechraten quer durch alle Genotypen.
- Zu guter Letzt: Eine kleine Pilotstudie mit drei DAA heilte die generell eher einfach kurierbaren Patienten mit Genotyp 1b innert nur drei Wochen. Die Patienten erhielten eine zufällige Kombination aus 3 direkt aktiven Substanzen mit Sofosbuvir, Ledipasvir, Daclatasvir, Asunaprevir oder Simeprevir. Eine grössere Studie muss diese erstaunlichen Ergebnisse bestätigen. Die SODAPI Studie wurde in Hong Kong mit ausschliesslich chinesischen Patienten durchgeführt.
David Haerry / Februar 2016
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Mit der Ausweitung der Limitatio für Daclatasvir (Daklinza©) per 1. Dezember 2015 (bisherige Vergütungen waren limitiert auf die Fibrosestadien 3 und 4, sprich Stadien mit schweren Leberschädigungen) können alle aktuell zugelassenen neuen Hepatitis-C-Medikamente bereits bei einem mittelschweren Leberschaden (Fibrosestadium 2) eingesetzt werden. Wie heute bekannt gegeben wurde, wird die Monatspackung um rund 2000 Franken günstiger und kostet neu 9‘634.10 Franken.
Dies ist vor allem für Patienten mit einer Hepatitis-C-Infektion mit dem Genotyp 3 eine gute Botschaft, da Daclatasvir (kombiniert mit Sofosbuvir (Sovaldi©)) bei diesen Patienten eine wichtige Behandlungsoption darstellt.
Diese Limitatio-Erweiterung stellt einen weiteren Schritt in Richtung der angestrebten Ziele der Hepatitis-Strategie und der Vision der Elimination von viraler Hepatitis in der Schweiz dar.
Bettina Maeschli / November 2015
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Die European AIDS Treatment Group EATG führt am Kongress jeweils eine Community Session zu einem frei bestimmten Thema durch. Heuer war das Thema PrEP, so wird die Prä-Expositions-Prophylaxe meist genannt. PrEP bedeutet, dass man präventiv Substanzen verabreicht, die in der HIV-Therapie verwendet werden, um eine HIV-Infektion zu verhindern. Es ist also klar eine präventive Massnahme.
In diversen Vorträgen ging es um die Kosteneffizienz der PrEP, die nachgewiesen zu sein scheint. Es wurden verschiedene prophylaktisch sinnvolle Settings diskutiert, um diese Technik gezielt einsetzen zu können. Z.B. werden die meisten MSM diese nicht benötigen. Hingegen soll sie bei Männern eingesetzt werden können, die offensichtlich mit konventionellen Präventionstechniken Mühe haben. Als Beispiele wurden erwähnt: Männer, die mehrmals (im gleichen Jahr) eine PEP verlangen oder anderswie auffällig riskant leben, Sex-Workers oder ChemSex-Konsumenten. Es ist in fast jedem Fall preisgünstiger und immer sinnvoller, HIV-Infektionen zu verhindern, als sie danach lebenslänglich zu behandeln. Immerhin geht es ja nicht nur um die betroffenen Personen selber, sondern eben auch um die, die mit diesen potentiell ungeschützte sexuelle Kontakte pflegen. Die Diskussionen sind etwas ähnlich wie früher, als man Gratiszugang zu sterilen Nadeln für Fixer und Kondomen gefordert hat, um Infektionen zu verhindern. Allerdings geht es hier um eine medizinische Prävention.
Im Weiteren wurden spezifische Probleme diskutiert. Truvada® ist nicht für präventiven Gebrauch zugelassen. Es gibt allerdings im Internet bereits relativ frei zugänglich ein grosses Angebot an generischen Produkten. Diese dürfen aber aufgrund der Patentschutzgesetze hierzulande weder eingeführt noch auf den Markt gebracht werden, auch wenn dies die Verfügbarkeit auch nicht besonders einschränken würde. Die Folge davon ist ein Schwarzmarkt analog zu Viagra, Poppers etc. Der Zugang zu PreP sollte sehr niederschwellig sein. Dennoch empfiehlt Prof Cristina Mussini eine Verschreibungspflicht durch einen Arzt. Eine engmaschige medizinische Überwachung macht nur schon aus der Sicht der anderen sexuell übertragbaren Krankheiten Sinn, weil diese damit wie Beifang früher in den Netzen hängen bleiben. Der Zugang zur PreP darf selbstverständlich nur HIV-Negativen erlaubt sein, da Truvada® nur Teil einer vollwertigen Therapie sein kann. Ein vorgängiger (negativer) Test ist also zwingend. Aus all diesen Gründen ist eine kontrollierte Abgabe sinnvoll und die momentan relativ freie Verfügbarkeit auf dem Schwarzmarkt keine gute Option.
Soweit ich bei der Session anwesend war, habe ich von keiner Seite ersthafte Einwände gegen den Einsatz von PrEP vernommen. Es wurde im Gegenteil Druck auf Gilead gemacht, den Zulassungsprozess von Truvada® als präventives Medikament möglichst zu beschleunigen.
VValo Bärtschi / November 2015
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Die durch Aids verursachte Sterblichkeit hat dank der Therapie massiv abgenommen. Aber bestimmte gesundheitliche Aspekte von Menschen mit HIV würde man gern mit der HIV-negativen Bevölkerung vergleichen. Das ist nicht einfach, weil gute Kontrollgruppen fehlen. Den SHCS-Autoren ist ein Vergleich mit der CoLaus Kohorte aus Lausanne und den FIRE-Daten gelungen. Die Resultate sind interessant und zum Teil überraschend.
Immer wieder wird die Lebenswartung von Menschen mit HIV diskutiert. Die Befürchtung, dass HIV-Patienten schneller alt werden und allgemein gebrechlicher sind als die Normalbevölkerung ist verbreitet. Menschen mit HIV sterben heute nur noch selten an den typischen, aids-definierenden Erkrankungen. Sie werden älter und entwickeln Mehrfacherkrankungen so wie die Normalbevölkerung auch. Die vorliegende Studie verarbeitet die Daten von fast 75'000 Personen, davon 3'230 Personen mit HIV.
Die Cohorte Lausannoise (CoLaus) bildet die Allgemeinbevölkerung ab. Sie beschäftigt sich vor allem mit Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes und psychiatrischen Erkrankungen. Die CoLaus ist mit elektronischen Patientendossiers und dem Todesfallregister verknüpft.
FIRE steht für „Family Medicine PCPC-Research using Electronic Medical Records“. 150'000 Patienten aus 75 allgemeinmedizinischen Praxen wurden mit Daten aus elektronischen Patientendossiers verknüpft.
Aus der CoLaus und der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie (SHCS) wurden Patienten ausgewählt, die Europäer, nicht Drogengebraucher, in den Jahren 2003 bis 2006 mindestens 35 Jahre alt waren und fünf bis sechs Jahre später mindestens einen ärztlichen Folgekontakt hatten. Ähnliche Kriterien galten für die Patienten aus FIRE. Diese Einschlussmerkmale hatten zur Folge, dass in den Jahren 2009-2011 alle Studienteilnehmer über 40-jährig waren. Diese Daten flossen dann in die Prävalenzanalyse.
Resultate
Die Patienten aus den Datenbanken von CoLaus und FIRE waren etwas älter, häufiger weiblich und hatten häufiger Übergewicht. Die Patienten aus der SHCS rauchten aber mehr als alle anderen. Mehrfacherkrankungen waren fast gleich häufig in CoLaus und SHCS (etwas mehr als ein Viertel der Patienten); aber nur halb so häufig in FIRE.
Herz-Kreislauferkrankungen (z.B. Herzinfarkte) waren bei allen Rauchern häufiger, egal ob HIV-positiv oder –negativ. Bluthochdruck, Nieren- und Lebererkrankungen waren bei HIV-positiven Patienten häufiger, egal ob es Rauchern oder Nicht-Raucher waren. Wichtig: Eine HIV-Infektion zusammen mit Rauchen erhöht das Risiko für einen Schlaganfall. Die Häufigkeit von Diabetes war unabhängig von Rauchen und HIV.
Die häufigsten Mehrfacherkrankungen in der HIV-Kohorte waren Bluthochdruck und Lebererkrankungen (29%), Bluthochdruck plus Diabetes (23%), oder Bluthochdruck plus Nierenprobleme (14%). In der CoLaus war die Kombination Bluthochdruck plus Diabetes mellitus am häufigsten (41%); Bluthochdruck plus Leber- oder Nierenerkrankungen liegen bei 14% und 12%.
In dieser Studie konnten wichtige Erkrankungen nicht berücksichtigt werden – Krebs, Osteoporose und Lungenerkrankungen fehlen. Das hat mit der fehlenden Kontrollgruppe zu tun, die CoLaus hat diese Daten nicht. Obwohl die CoLaus Patienten sehr wahrscheinlich gesundheitsbewusste Menschen sind, weisen sie im Vergleich mit der SHCS-Gruppe nicht weniger Herz-Kreislaufrisiken auf. Das ist eine überraschende Erkenntnis – sie spricht für die Qualität der Behandlung und eine optimale Betreuung der HIV-Patienten.
Schlussfolgerungen
Die Studie zeigt, dass Bluthochdruck, Leber- und Nierenerkrankungen bei Menschen mit HIV generell häufiger sind. Herz-Kreislauferkrankungen treten häufiger bei Rauchern auf. Aus ärztlicher Sicht müssen bei Menschen mit HIV vor allem die Bemühungen um Raucherentwöhnung und Änderungen des Lebensstils (z.B. Ernährung, Gewichtsabnahme) verstärkt werden. Ferner müssen Blutdruck sowie Nieren- und Leberfunktionen gut überwacht werden, um das Risiko von Mehrfacherkrankungen und Medikamenteninteraktionen tief zu halten.
Für Menschen mit HIV heisst das auch: Nicht zu rauchen oder mit dem Rauchen aufzuhören, ist das wichtigste was sie selber für ihre langfristige Gesundheit beitragen können.
An einer Raucherentwöhnung interessiert?
Folgende SHCS Zentren haben bestehende Raucherentwöhnungsprogramme:
- Basel, Universitätsspital
- Basel, Bruderholz: Patienten werden beraten und extern überwiesen
- Bern, Inselspital
- Genf, Hôpital Cantonal et Universitaire
- Lausanne, CHUV
- St. Gallen, Kantonsspital
- Zürich, Universitätsspital
Die Programme sind offenbar erfolgreich. Der Anteil der Raucher in der Kohortenstudie lag im Jahr 2000 auf gut 60%, heute sind es noch ungefähr 40%. Patienten, die in einer privaten Praxis in Behandlung sind, sollten ihren Arzt auf das Thema ansprechen.
David Haerry / November 2015
[1] Strong impact of smoking on multimorbidity and cardiovascular risk among human immuodeficiency visrus-infected individuals in comparison with the general population; B. Hasse et al, Open Forum Infectious Diseases, DOI: 10.1093/ofid/ofv108
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Die Gesellschaft der europäischen Kliniker aktualisiert jeweils im Oktober die Behandlungsrichtlinien. Die an der Europäischen Aids-Konferenz in Barcelona veröffentlichten EACS Richtlinien werden stark beachtet, weil sie den Konsens der Europäer abbilden und sehr praxisorientiert geschrieben sind. Wenig überraschend empfehlen nun auch die Europäer die sofortige HIV-Therapie für alle Menschen mit HIV. Damit ist der alte Streit „wann beginnen“ beigelegt. Weiterhin ist keine Harmonie beim „womit“ in Sicht.
HIV Therapie
„Wann wir beginnen sollen, das war für einmal der einfachste Teil der Arbeit“, meint Dr. José Gatell bei der Präsentation der neuen Richtlinien. Auch Europa hat bei der START-Studie mitgemacht (http://goo.gl/dPrPgK).
Neue Daten zum Einsatz der Integraseinhibitoren Dolutegravir und Raltegravir sind es vor allem, die für unterschiedliche Expertenempfehlungen sorgen. Das führt zu unterschiedlichen Empfehlungen in den Industrieländern, weil diese Moleküle in ärmeren Ländern noch nicht zur Verfügung stehen.
Beim sogenannten „Rückgrat“ der Therapie, den Nicht-nukleosidanaloga NRTI ist man sich weitgehend einig. Alle internationalen Richtlinien empfehlen Truvada (Emtricitabine und Tenofovir). Die Kombination Kivexa (Abacavir & Lamivudine) wird von EACS und den amerikanischen Richtlinien IAS-USA und DHHS ebenfalls empfohlen; die englischen Richtlinien der BHIVA sind etwas reserviert, man hat dort etwas Bedenken bei Patienten mit erhöhter Viruslast. Die WHO empfiehlt Kivexa überhaupt nicht, weil in vielen Ländern im Süden der genetische Test zum sicheren Einsatz von Abacavir nicht eingesetzt werden kann.
Am wenigsten eindeutig sind die Richtlinien jedoch beim dritten Medikament. Hier sorgt vor allem das alte Stocrin (Komponente von Atripla) für Diskussionen. Die alte Speerspitze der Therapie wird seit 1998 bevorzugt eingesetzt, und die WHO bleibt weiterhin dabei, entweder als Atripla oder Stocrin in Kombination mit Truvada. Von der Wirksamkeit her gesehen kann man das verstehen. Diese Kombination funktioniert extrem gut und gibt den Patienten auch die Freiheit, es mit dem Zeitpunkt der Einnahme der Therapie nicht so genau zu nehmen. Es macht gar nichts, wenn man am Wochenende 5, 6 Stunden später ins Bett geht und die Therapie erst dann nimmt. Trotzdem möchte der Schreibende mal die WHO probehalber unter Stocrin setzen – die Meinungen würden sich wohl rasch ändern. Ein Medikament mit dermassen schwerwiegenden Nebenwirkungen (vor allem im zentralen Nervensystem), gehört in die Mottenkiste verbannt. Alle anderen Richtlinien ausserhalb der WHO tun das auch – Atripla / Stocrin ist weg vom Tisch.
Die übrigen Richtlinien zeigen, dass hier die Meinungsbildung noch im Gange ist. DHHS wurde auch 2015 aktualisiert – die Klasse der NNRTI (dazu gehört Stocrin) wird nicht mehr für eine Ersttherapie empfohlen. DHHS empfiehlt nur noch Integraseinhibitoren sowie einen Proteaseinhibitor, Darunavir (Prezista).
IAS USA hat 2014 aktualisiert und empfiehlt noch 11 verschiedene Kombinationen zum Therapiestart, inklusive Efavirenz/Stocrin sowie die anderen NNRTI Etravirine und Rilpivirine und denProteaseinhibitor Atazanavir.
Die EACS hat sich ein wenig zwischen diese beiden extremen Positionen gesetzt. Man empfiehlt sechs Kombinationen zum Starten, vier davon mit Integraseinhibitoren (Truvada mit Dolutegravir, Truvada mit Raltegravir, die Kombipille Triumeq (Dolutegravir mit Kivexa) sowie Stribild (Truvada plus geboostetes Elvitegravir). Hinzu kommen für die Europäer die NNRTI Kombipille Complera/Eviplera (Truvada plus Rilpivirine) sowie Truvada plus geboosteten Proteaseinhibitor Darunavir.
In der Paneldiskussion wurde vor allem wegen Efavirenz/Stocrin gestritten. Die Europäer finden, die WHO würde besser einen Proteaseinhibitor einsetzen (wegen dem niedrigen Resistenzrisiko); die WHO möchte erst in 2-3 Jahren auf neue Pferde setzen, wenn Dolutegravir in einer generischen Form zur Verfügung stehen könnte.
PrEP und PEP
Hier sorgte die EACS für eine kleine Überraschung. Noch nie hat die Gesellschaft eine Intervention empfohlen, welche von den europäischen Behörden gar nicht zugelassen ist – es geht um Truvada als Prä-Expositionsprophylaxe in der Prävention von HIV. Die Studien PROUD und IPERGAY haben für die EACS die Frage nach Sinn oder Unsinn der PrEP eindeutig beantwortet. Die EACS äusserte sich gegen Ende der Konferenz noch mit einer Pressemitteilung, um dieser Meinung Nachdruck zu verleihen.
Allerdings schaut die EACS über die Vorbehalte wegen Nebenwirkungen der PrEP und dem fehlenden Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen nicht hinweg. Für die Gesellschaft gehört der Einsatz der PrEP in die Hände erfahrener HIV-Kliniker, was deren Einsatz bei HIV-negativen Patienten nicht gerade erleichtert.
Die EACS ändert ihre Meinung auch zur Post-Expositionsprophylaxe PEP, der, „Pille danach“. Die PEP wird nicht mehr empfohlen, wenn der zweite Partner unter Therapie mit unterdrückter Viruslast ist, und man empfiehlt nur noch Truvada plus Darunavir geboostet oder Raltegravir.
Hepatitis C Ko-Infektion
Die EACS empfiehlt den Einsatz von pegyliertem Interferon nicht mehr – was aus Patientensicht wegen der Nebenwirkungen sehr zu begrüssen ist. Doch der EACS ist bewusst, dass die neuen direkt wirksamen Therapien noch nicht in allen Ländern zur Verfügung stehen.
Mehrfacherkrankungen und Älterwerden
Dieses Kapitel der europäischen Richtlinien ist ein wenig deren Filetstück und der besondere Stolz der Gesellschaft. Georg Behrens, für diesen Teil mitverantwortlich, meinte denn auch bei der Präsentation, dass dieser Teil seit der letzten Ausgabe am meisten weiterentwickelt wurde. Es geht hier um älter werdende Patienten mit HIV, Krebs, Depressionen usw. Bei den älteren Patienten zeigen sich gewisse Erkrankungen häufiger oder in schwerer Form. Die sorgfältige Überwachung zum Beispiel der Nierenfunktion, aber auch der psychischen Gesundheit der Patienten ist also zentral.
Diskussion im Plenum
Aus dem Publikum kamen vor allem Fragen puncto Relevanz der Empfehlungen für Osteuropa – sprich Integraseinhibitoren, neue HCV-Therapien und PrEP. Die Preisdiskussion findet auch in Europa statt, und einige Entwicklungen sind schlicht nicht nachvollziehbar. Nachdem die Zulassungsbehörden alle Entscheidungen transparent kommunizieren und die Daten offenlegen, herrscht beim Thema Preise dicker Nebel. Mitverantwortlich sind hier auch die nationalen Behörden – man ist offenbar der irrigen Meinung, man könne ein bisschen mehr rausholen als der Nachbar, wenn man dies hinter verschlossenen Türen tut.Von Seiten der EACS will man sich für eine Verbesserung der Situation in Osteuropa einsetzen.
Hinweis für Patienten
Wenn Sie sehen, dass ein Medikament, das Sie nehmen, nicht mehr empfohlen wird, diskutieren Sie das mit Ihrem Arzt. Vielleicht ist ein Wechsel richtig und wichtig, vielleicht gibt es aber Gründe, beim bestehenden Medikament zu bleiben. Was gut verträglich ist und funktioniert, sollte man im Prinzip behalten. Der Autor nimmt selber Medikamente, die in dieser Kombination noch nie von irgendeiner Richtlinie empfohlen wurden und fährt ganz gut damit.
David Haerry / November 2015
Seite 5 von 11