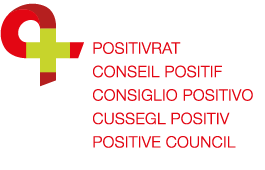Aktuell
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Was Neuansteckungen mit HIV anbelangt, ist die Schweiz ist in einer eher komfortablen Lage – die Meldungen sind tendenziell seit Jahren rückläufig. Dies betrifft vor allem Neuansteckungen von Frauen. Sogar bei Männern die Sex mit Männern haben sind die neuen Ansteckungen eher rückläufig bis stabil. Das ist besonders ungewöhnlich in Europa. Trotzdem ist es interessant zu verstehen, in welchen Situationen HIV heute übertragen wird. Die HIV-Kohortenstudie hat dazu neue Informationen.
Der Beitrag der antiretroviralen Therapie zur HIV-Prävention wird heute weltweit anerkannt, denn Patienten mit unterdrückter Viruslast können HIV nicht mehr übertragen. Seit alle Therapierichtlinien weltweit auch die sofortige Therapie nach Diagnose empfehlen, sollte sich dies in sinkenden Ansteckungsraten niederschlagen. Wenn aber die Strategie funktionieren soll, müssen wir besser verstehen wann und warum HIV in der Schweiz heute noch übertragen wird.
Um die Übertragungsmuster in der Schweiz zu verstehen, wurden ein phylogenetischer Baum aus fast 20'000 schweizerischen und 91’000 ausländischen Virussequenzen erstellt. Aus diesem Datenpool wurden schliesslich die zu untersuchenden Transmissions-Paare aus der Schweiz indentifiziert.
Die Resultate lassen an Deutlichkeit wenig zu wünschen übrig. 44% der HIV-Übertragungen passieren im ersten Jahr einer Infektion. Die Wahrscheinlichkeit, dass der das Virus übertragende Partner nichts von seiner Infektion weiss ist also sehr gross. Das zweitgrösste Risiko für ein HIV-Übertragung sind Therapieunterbrüche – 14% aller Neuansteckungen werden so verursacht.
Für die HIV-Präventionsarbeit in der Schweiz sind das enorm wichtige Informationen. Fast 60% der Neuansteckungen passieren, weil die Leute sich frisch infiziert haben und nichts von ihrer Ansteckung wissen oder weil sie einfach die Therapie absetzen. Das heisst also, dass Menschen mit einem lebhaften Sexualleben mit mehreren Partnern unbedingt häufiger testen sollten als sie dies heute tun. Menschen, die sich frisch infiziert haben, sind besonders ansteckend weil sie sich ungenügend schützen und zusätzlich wegen der besonders hohen Viruslast während der Primo-Infektion (damit bezeichnet man die ersten zwei bis drei Monate nach einer Ansteckung). Unwissen und Biologie spielen sich also gegenseitig in die Hände.
Zum Zweiten müssen wir den Patienten besser erklären, dass sie unter Therapie auch ihre Sexualpartner schützen. Man soll ihnen noch besser einschärfen, ihre Therapie auf keinen Fall zu unterbrechen. Kleine Massnahmen also, und mit grossem Nutzen für das Gesundheitssystem.
Aufgrund dieser Daten müssen wir die heutigen Aufwendungen für die HIV-Prävention hinterfragen. Die gut sichtbare, aber kostspielige Love-life Kampagne lässt sich definitiv nicht mehr rechtfertigen. Gefragt ist nicht Spektakel, sondern bessere zielgruppenorientierte Feinarbeit.
David Haerry / Juli 2016
1 Alex Marzel et al, Swiss HIV Cohort Study SHCS, Clinical Infectious Diseases September 19, 2015, DOI: 101093/cid/civ732
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Wie steht es um Arbeitsfähigkeit und Beschäftigungsgrad von Menschen mit HIV unter Therapie? Sehr viele Daten gibt es dazu nicht – eigentlich erstaunlich, wo sich doch dank der sehr erfolgreichen Therapien in diesem Bereich einiges verändert hat. Die Forscher der Schweizerischen HIV-Kohorte SHCS untersuchten dazu die Daten von Patienten unter sechzig Jahren, welche zwischen 1998 und 2012 eine HIV-Therapie begannen.
Noch vor zwanzig Jahren bedeutete die Diagnose HIV eine mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretende Erkrankung und damit oft auch den Verlust des Arbeitsplatzes. Dank der funktionierenden antiretroviralen Therapie hat sich das Bild verbessert. Es wurden aber einige Hürden beobachtet, welche den Patienten den Wiedereinstieg ins Berufsleben erschwerten – wichtige Themen waren die Nebenwirkungen der Therapie sowie Diskriminierungen. Die SHCS untersuchte die Lage letztmals im Jahr 2004 und bezifferte den jährlichen Produktionsverlust von 5'000 Patienten auf 122 Millionen Franken. Damals war die Arbeitsunfähigkeit klar verbunden mit höherem Alter, aids-definierenden Erkrankungen, früherem Gebrauch von intravenös verabreichten Drogen und tiefen CD4-Werten. Eine bessere Ausbildung sowie eine stabile Partnerschaft waren mit einem höheren Beschäftigungsgrad verbunden. Damit war auch klar, dass sozioökonomische Faktoren das Geschehen beeinflussten.
In der eben publizierten neuen Untersuchung wurden Daten von 5’800 Personen berücksichtigt 1. Davon waren drei Viertel bei Therapiebeginn voll arbeitsfähig; jeder zehnte arbeitete Teilzeit und 16% waren arbeitsunfähig. Die Hälfte der arbeitsunfähigen Gruppe war unter Therapie innerhalb eines Jahres entweder teilweise oder ganz arbeitsfähig.
Gewannen im Zeitraum 1998 bis 2001 nur 24% der Patienten ihre volle Arbeitsfähigkeit innerhalb eines Jahres wieder, so stieg dieser Wert zehn Jahre später auf 41%. Der Beschäftigungsgrad der Patienten erhöhte sich aber nicht. Waren 1998 bis 2001 bei Therapiebeginn zwei Drittel der Patienten voll arbeitsfähig, waren es zehn Jahre später bereits 86%. Über einen Zeitraum von 5 Jahren verbesserte sich die Situation ebenfalls. Fast alle nach einem Jahr Therapie arbeitsfähigen Patienten konnten nach 5 Jahren Therapie immer noch einer Arbeit nachgehen (87,5%); nur bei knapp 6% hatte sich die Arbeitsfähigkeit verschlechtert. Allerdings lebten nur 71% der arbeitsfähigen Patienten auch vom Arbeitseinkommen. Die arbeitsunfähigen Patienten lebten zu fast 90% von einem Einkommen aus Versicherungen.
Die Daten zeigen eine deutliche Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der HIV-Patienten seit 1998. Trotz tiefer Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat sich aber der Anteil der Patienten, die ganz von ihrem Arbeitseinkommen leben, nicht erhöht.
Die offensichtlichen Fortschritte in der Behandlungsqualität lassen sich über die 14-jährige Beobachtungsperiode gut nachvollziehen. Eindeutig ist der bessere Gesundheitszustand der Patienten beim Therapiebeginn: Seit vielen Jahren wird in der Schweiz die Therapie eher früh eingeleitet und seit einiger Zeit sogar gleich nach der Diagnose. Es zeigt sich aber, dass wer einmal erkrankt und deswegen arbeitsunfähig wird, nur sehr schwer wieder in einen normalen Arbeitsprozess integrierbar ist. Es wäre jetzt sehr wichtig, herauszufinden, welche Massnahmen diesen Missstand beheben könnten. Dabei könnte man zum Beispiel an Weiterbildung von Vorgesetzten denken oder die Kommunikation zwischen behandelnden Ärzten und Arbeitgebern verbessern. Auch eine Aufklärungskampagne wäre sicher eine gute Idee.
Walter Bärtschi, David Haerry / Mai 2016
1 E. Elzi et al, “Ability to Work and Employment Rates in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-1-Infected Individuals Receiving Combination Antiretroviral Therapy: The Swiss HIV Cohort Study”, OFID, DOI: 10.1093/ofid/ofw022
EACS Konferenz Oktober 2015: Die HCV-Therapie senkt das Todesfallrisiko von ko-infizierten Patienten
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Das Risiko, an einer Lebererkrankung zu sterben, sinkt deutlich, und verbesserte allgemeine Überlebensraten – das sind in Kürze die Ergebnisse einer Analyse von 3'500 Patienten, welche an der EACS in Barcelona präsentiert wurde. Bei einer ähnlichen Studie wurde gezeigt, dass leberbedingte Erkrankungen zurückgehen, aber Leberkarzinome bei ko-infizierten Patienten ein Risiko bleiben. Die vorgestellten Studien beleuchten die heute veralteten Interferon-basierten Therapien, sie sind aber wegen der langen Beobachtungszeit trotzdem aufschlussreich.
Eine chronische HCV-Infektion führt über Jahre oder Jahrzehnte zu schweren Schädigungen der Leber – zum Beispiel durch eine Leberzirrhose, ein sogenanntes hepatozelluläres Karzinom oder Leberversagen, welches eine Transplantation erforderlich macht. Aus der Forschung wissen wir auch, dass die Erkrankung bei ko-infizierten Patienten rascher fortschreitet als bei Menschen, die sich nur mit einer Hepatitis-C allein infiziert haben.
COHERE (Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research in Europe) ist eine Zusammenarbeit von 33 Kohortenstudien in Europa, welche alle Altersklassen abbildet. Die Grösse von COHERE ermöglicht die Beantwortung von Fragestellungen, welche eine einzelne Kohorte nicht beantworten kann.
Die Hepatitis Subgruppe von COHERE hat das langfristige allgemeine Todesfallrisiko, das Risiko von leberbedingten und nicht leberbedingten Todesfällen von ko-infizierten Patienten und die Auswirkungen einer Hepatitis-C Therapie in einer grossen Multikohortenanalyse angeschaut. 18 COHERE Partnerkohorten machten mit, inklusive die Schweizerische HIV-Kohorte SHCS.
In die Untersuchung eingeschlossen wurden Patienten, welche eine auf Interferon basierende Hepatitis-C Therapie begonnen haben und anschliessend für 96 Wochen beobachtet wurden. Die ganz neuen, interferonfreien Therapien konnten noch nicht berücksichtigt werden. Fast 80% der Patienten waren Männer, 60% haben in der Vergangenheit Drogen gespritzt. Im Durchschnitt waren die Patienten 42-jährig. Die meisten hatten zudem eine HIV-Therapie. Mehr als die Hälfte hatten HCV Genotyp 1; und 4% der Patienten waren dreifach infiziert (HIV, Hepatitis B und C).
Die Patienten wurden in drei Gruppen eingeteilt:
- Erfolgreich therapierte: erhielten 24 Wochen Interferon/Ribavirin und der letzte HCV Nachweistest war negativ (Virus nicht mehr nachweisbar)
- Erfolglos therapierte: erhielten weniger als 24 Wochen Interferon/Ribavirin (offenbar unwirksame Therapie) oder der letzte HCV Nachweistest war positiv (Virus nachweisbar)
- Erfolg nicht bekannt: erhielten 24 Wochen Interferon/Ribavirin, Informationen betreffend HCV Nachweistest fehlen.
3'500 Patienten wurden in die Untersuchung eingeschlossen. 28,5% gehören zur ersten Gruppe (erfolgreich therapiert); 45,3% zur zweiten (erfolglos therapiert) und bei 26,2% war der Erfolg nicht bekannt (Gruppe drei). Wenn man die drei Gruppen näher anschaut, zeigt sich, dass die erfolgreich behandelten später therapiert wurden (2007 gegenüber 2005), weniger häufig Drogen gespritzt haben (47% gegenüber 65% und häufiger Hepatitis B hatten. Auch hatten sie bessere CD-4 Werte und waren weniger häufig an Aids erkrankt.
Die erfolgreich therapierten hatten weniger häufig Genotyp 1 (dieser reagiert weniger gut auf eine Therapie mit Interferon). Die Forscher untersuchten die Überlebenszeit ab Woche 96 nach Behandlungsbeginn bis zum Todesfall oder bis zur letzten medizinischen Untersuchung. Insgesamt 213 Patienten verstarben innerhalb der Nachbeobachtungszeit von durchschnittlich 3,8 Jahren.
Die generelle Todesfallrate war bei den erfolgreich therapierten etwa halb so hoch wie bei den erfolglos therapierten. Wenn man nur die leberbedingten Todesfälle anschaut, wird der Unterschied noch grösser – nicht erfolgreich therapierte starben 4,5 mal öfter an leberbedingten Erkrankungen als erfolgreich behandelte.
Fazit und für uns heute wichtig:
- Die Heilungsraten werden sich beim Einsatz der neuen, interferonfreien Substanzen nochmals deutlich verbessern, dies bei weniger Nebenwirkungen und kürzerer Therapiedauer
- Der Effekt auf die Todesfallraten wird sich also noch verstärken
- Zulange warten bis eine Hepatitis C therapiert wird, lohnt sich nicht, denn wir haben es mit einer systemischen Erkrankung zu tun.
Trends betreffend Leberkrebs (hepatozelluläre Karzinome) und Lebererkrankungen
Diese Analyse bezieht sich auf die Jahre 2001 bis 2014. Berücksichtigt wurden Daten ko-infizierter Patienten aus den Studien von EuroSIDA, der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie SHCS, einer kanadischen sowie einer amerikanischen Koinfektionskohorte.
Mehrheitlich Männer (68%), im Durchschnitt 38 Jahre alt und 60% ehemalige Drogengebraucher, 5% mit einer zusätzlichen Hepatitis-B Infektion. Der Hepatitis-C Status wurde durch Antikörper bestimmt, nicht durch Bestimmen der Viruslast. Einige Studienteilnehmer könnten daher die Hepatitis-C spontan ausgeheilt haben.
Insgesamt wurden 72 Fälle von Leberkrebs und zusätzlich 375 weitere Lebererkrankungen beobachtet, während einer kumulierten Beobachtungszeit von 45'000 Personenjahren. Patienten mit Leberkrebs waren etwas älter als jene mit anderen Lebererkrankungen und waren häufiger mit einer Hepatitis-B infiziert. Sie waren auch häufiger unter antiretroviraler Therapie und hatten höhere CD4-Werte.
Während der Beobachtungszeit stieg die Häufigkeit von Leberkrebs massiv von 0.4 auf 2.3 Fälle pro 1’000 Personenjahre. Gegenläufig sanken aber gleichzeitig die anderen Lebererkrankungen. Das stärkste Vorzeichen auf Leberkrebs war eine Leberzirrhose. Höheres Alter und Hepatitis-B verstärken das Risiko, während bessere CD4-Werte schützend wirken. Die Autoren nehmen an, dass der Leberkrebs zunahm, weil zugleich auch die Zirrhosefälle häufiger auftraten.
Was bedeutet das für uns?
In einer anschliessenden Debatte, ob eine Heilung von HCV „alle Probleme löst“ zeigten sich Juan Berenguer aus Madrid und Stefan Mauss aus Düsseldorf einig und beleuchteten leberbedingte Resultate und extra-hepatische Auswirkungen der Hepatitis-C Infektion (Erkrankungen ausserhalb der Leber).
Die bekannten Studien zeigen übereinstimmend, dass eine erfolgreiche Therapie die Anzahl leberbedingter Komplikationen wie fortgeschrittene Fibrose, Zirrhose und Blutdruckanstieg in der Leberportalvene reduziert. Trotzdem besteht für HCV-Patienten auch nach einer Heilung ein erhöhtes Risiko, an Leberkrebs oder einer dekompensierten Leberzirrhose zu erkranken – eine Überwachung der Leber ist also trotz Heilung weiterhin nötig. Die Auswirkungen einer Heilung auf Erkrankungen ausserhalb der Leber sind hingegen weniger deutlich – man denke an die Kryoglobulinämie (Gefässentzündung), Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauferkrankungen. Die Aussichten für die Patienten verbessern sich zwar, und die leberbedingten Todesfälle nehmen ab. Auf die Erkrankungen ausserhalb der Leber hat aber die Therapie vor allem dann einen Einfluss, wenn die Fibrose noch wenig fortgeschritten ist.
Diese Beobachtungen sind ein Fingerzeig auf die negativen Auswirkungen von Behandlungslimitationen wie sie in der Schweiz leider immer noch vorkommen.
David Haerry / Februar 2016
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Nachdem in gewisser Weise bereits ein möglichst früher Einsatz der ART ein sehr effizientes Mittel ist, Neuinfektionen zu reduzieren, könnte das Feuer nun auch in den letzten ‚Infektionsherden‘ zum Erlöschen gebracht werden.
Wir müssen heute einsehen, dass es für einige promisk lebende Männer (meist MSM, auch MSW) sehr schwierig ist, sich an die klassischen Safer Sex-Regeln zu halten. Häufig spielen auch Partydrogen eine wichtige Rolle (ChemSex). Es liegt nicht in unserem Ermessen, dies zu qualifizieren. Lange gab es für dieses Setting keine Strategien, heute gibt es aber die äusserst effiziente PrEP. Vor allem aus London, Paris und den USA gibt es eine zunehmende Zahl neuer Erfahrungswerte, die die Möglichkeiten der PrEP klar zeigen. Durch die prophylaktische Einnahme von Truvada (einem Kombipräparat, das bekanntlich auch als Element einer regulären ART eingesetzt werden kann) wird die Übertragungskette für das HI-Virus unterbrochen. Es geht darum, speziell denen, die inadäquate Risikostrategien haben, ein hocheffizientes Prophylaxeinstrument zur Verfügung zu stellen. Es hat sich in diversen Studien gezeigt, dass dies wesentlich effizienter ist als eine kondomorientierte Prävention. Das macht vor allem aus der Perspektive Sinn, dass damit mittelfristig die Prävalenz in der Community gesenkt werden kann. Der Einwand, dass dies nur für HIV und nicht für die anderen STI funktioniert, ist absolut berechtigt, andererseits ändert sich ja am Risikoverhalten dieser eng definierten Gruppe eh nichts, es ist also kein Anstieg der anderen bakteriellen oder viralen STI zu erwarten.
Wir fordern aus diesen Gründen von unseren Behörden und Organisationen (BAG, Swissmedic, SantéSuisse) ein unkompliziertes Zulassungsprozedere und eine akzeptable Verrechnungspraxis für Truvada im Sinne einer PrEP. Die Krankenkassen müssen einsehen, dass es entgegen ihrer eigentlichen Aufgabe, nur konkrete Krankheitskosten zu übernehmen, absolut Sinn machen kann, auch präventive Massnahmen zu unterstützen.
In Frankreich nota bene, und teilweise auch in Grossbritannien und den USA ist diese Prävention bereits möglich. Leider ist unser nur auf kurative Techniken ausgelegtes Gesundheitswesen (KVG) in dieser Hinsicht etwas sperrig und nicht dynamisch.
VValo Bärtschi / April 2016
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Es gibt zwei Methoden um den Gesundheitszustand der Leber bei Menschen mit Hepatitis C zu messen: traditionell mit einer invasiven Gewebeprobe (Biopsie), oder modern mit einem nicht-invasiven Fibroscan. Die Patienten muss man nicht fragen was sie lieber haben: der Fibroscan ist einfach und viel angenehmer als die Gewebeprobe. Die Kohortenstudie verglich die Genauigkeit verschiedener nicht invasiver Methoden mit der Biopsie. Das Ergebnis: Vor allem eines der nicht-invasiven Nachweisverfahren ist allen anderen, inklusive der Gewebeprobe überlegen.
An fünf verschiedenen Abteilungen in St. Gallen, Bern und Zürich wurden mehrere nicht-invasive Testverfahren (NIT) zur Diagnose des Fortschreitens einer Leberfibrose und Zirrhose als Folge der Hepatitis C-Infektion untereinander und mit der bisher als Gold-Standard geltenden Leberbiopsie verglichen. Die Studie wurde an HIV/HCV-Ko-infizierten durchgeführt, da bei diesen Patienten die Fibrose am schnellsten fortschreitet. Die Biopsie gilt als am zuverlässigsten, weil man dabei eine kleine Menge Lebergewebes aus dem Körper entnimmt, diese so genauer untersuchen kann und viele Informationen über den Gesundheitszustand der Leber erhält. Allerdings ist sie eben invasiv (d.h. bedingt einen kleinen Eingriff zur Entnahme) und birgt entsprechend gewisse Risiken, wie Blutungen (abhängig von der Gerinnungs-Situation des Patienten) und Verletzungen der Nachbarorgane. Deswegen sind die Ärzte bestrebt, diese Diagnosetechnik durch weniger belastende und auch preisgünstigere Techniken zu ersetzen. Ein weiteres Augenmerk wurde auch der Verlaufskontrolle und dem Fortschreiten der Fibrose geschenkt.
Die meisten der nicht-invasiven Verfahren untersuchen sehr spezifische Parameter im Blut, die am weitesten verbreitete Alternative zur Biopsie, die ‚Transiente Elastographie‘ benötigt eine Art Ultraschall-Gerät, den ‚FibroScan’.
Die Schlussfolgerung der Studie ist relativ klar. Die untersuchten Blutparameter, die mit dem Fibrosegrad korrelieren sollen, sind weniger aussagekräftig, als der Ultraschall-basierte FibroScan, der die verlässlichsten Resultate liefert. Der FibroScan lieferte sowohl zuverlässige Resultate zur Diagnose einer fortgeschrittenen Fibrose als auch zur Zirrhose. Eine Verlaufskontrolle 3 Jahre nach der ersten Messung zeigte, dass beim Grossteil der HIV/HCV ko-infizierten Patienten der Fibrosegrad nicht wesentlich fortgeschritten war. Diese Beobachtung zeigt, dass HCV eine langsam fortschreitende Infektion ist.
Zusammenfassend unterstützen die Resultate die neuen Empfehlungen der EASL 1 , in erster Linie auf nicht-invasive Verfahren bei der Diagnose und zur Verlaufskontrolle einer Leberfibrose einzusetzen.
Für die Patienten sind das sehr gute Nachrichten. Das Bundesamt für Gesundheit wollte noch vor einem Jahr eine HCV-Therapie bloss aufgrund einer durch Gewebeprobe bestimmten fortgeschrittenen Lebererkrankung bewilligen. Diese Studie zeigt definitiv, dass es auch anders geht.
Walter Bärtschi, David Haerry / Februar 2016
1) EASL: European Association for the Study of the Liver, die europäische Fachgesellschaft der Hepatologen
Seite 4 von 11