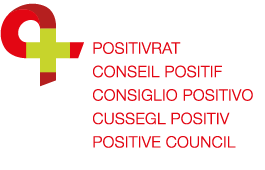Aktuell
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Wieviele HIV-Patienten nehmen nicht nur die HIV-Medikamente, sondern auch andere Präparate ein? Kann das zu Wechselwirkungen führen? Und welchen Einfluss haben diese Ko-Medikationen auf die Wirksamkeit der HIV-Therapie? Diesen Fragen ging eine im März 2010 publizierte prospektive Studie unter den Teilnehmenden der Schweizer HIV-Kohortenstudie (SHCS) nach.
Im Management einer HIV-Infektion sind Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen der antiretroviralen Therapie (ART) und anderen Medikamenten zunehmend ein wichtiges Thema. Medikamentöse Wechselwirkungen können zu Toxizität (Giftigkeit) führen oder aber die Wirksamkeit von antiretroviralen Medikamenten mindern und damit Resistenzen hervorrufen. Das Thema wird nicht zuletzt wegen des grossen Erfolgs der ART immer wichtiger. Diese verlängert die Lebenserwartung HIV-positiver Menschen in hohem Masse, was dazu führt, dass immer mehr altersbedingte Erkrankungen auftreten – genau wie bei der Allgemeinbevölkerung.
Bei HIV-Patienten und Patientinnen muss die Behandlung dieser Krankheiten immer mit der ART abgestimmt werden. Dasselbe gilt im Falle von Ko-Infektionen (z.B. mit Hepatits B oder C), die bei HIV-positiven Menschen relativ häufig vorkommen. Aber auch alternative Heilmittel, die von PatientInnen selbst gekauft werden, können zu Wechselwirkungen führen.
Als Grundlage der Studie dienten die klinischen Daten aller Kohorten-Teilnehmenden, die von April 2008 bis Januar 2009 eine ärztliche Sprechstunde besuchten. Zudem wurden Patienten über selbst gekaufte und eingenommene Heilmittel befragt. Die Analyse von möglichen (nicht realen und eingetroffenen!) Wechselwirkungen wurde mithilfe von Medikamenten-Datenbanken sowie pharmazeutischen Experten durchgeführt. Daraus formulierte die Forschungsgruppe um Catia Marzolini vom Universitätsspital Basel Empfehlungen für die Absetzung oder Neuanpassung von Therapien. Ein Fragebogen an die behandelnden Ärzte und Ärztinnen erhob danach die getroffenen Massnahmen.
Ko-Medikationen sind häufig
68% der Patienten und Patientinnen (1‘013 von 1‘497) nahmen neben den antiretroviralen Medikamenten noch andere ärztlich verschriebene Präparate ein. 59% dieser Ko-Medikationen (597 von 1‘013) wiesen potentielle Wechselwirkungen auf, die eine Neudosierung und/oder genaue Beobachtung erfordern. Bei rund der Hälfte davon handelte es sich um Medikamente zur Behandlung des zentralen Nervensystems (dazu gehören einige Antidepressiva), über ein Drittel waren Mittel gegen Herz- und Kreislaufkrankheiten und bei fast einem Fünftel handelte es sich um Methadon.
Um gefährliche oder schädliche Wechselwirkungen handelte es sich aber „nur“ in 2% (21 von 1‘013) resp. 4 % (42). In 2% der Fälle waren die zusätzlich verabreichten Medikamente kontraindiziert, d.h. ihre Anwendung ist bei gleichzeitiger Einnahme von bestimmten HIV-Medikamenten verboten oder nur in absoluten Ausnahmefällen zugelassen. Bei 4% bestand die Möglichkeit, dass die Ko-Medikationen die Wirksamkeit der antiretroviralen Therapie mindern könnten.
Erfreulich: die Ärzte wissen, was sie tun
Ko-Medikationen waren zwar häufig, solche mit potentiell schädlichen und gefährlichen Wechselwirkungen hingegen selten. Das erfreuliche Fazit: Die potentiellen Wechselwirkungen beeinflussten weder die Nachweisbarkeit der Viruslast noch die Anzahl der CD4-Zellen. Diese unterschieden sich nämlich nicht bei Patienten mit Ko-Medikationen und solchen mit und ohne potentielle Wechselwirkungen. Dass die Anzahl der potentiell gefährlichen oder schädlichen Wechselwirkungen so klein war, führen die Forscher und Forscherinnen auf die Professionalität und die Spezialisierung der Ärzte und Ärztinnen in den der Kohorte angeschlossenen HIV-Behandlungszentren zurück. Denn die überwiegende Mehrheit der potentiellen Wechselwirkungen sind gut handhabbar, wenn bei Ko-Medikationen die Therapie genau beobachtet wird und nötige Anpassungen der Dosierung oder Kombination vorgenommen werden. Die Autoren der Studie weisen jedoch darauf hin, dass in anderen Settings, wo Fachpersonen nicht auf HIV spezialisiert sind, eventuell mehr potentiell schädliche Ko-Medikationen verabreicht würden.
Text: Shelley Berlowitz
C. Marzolini et al: Prevalence of comedications and effect of potential drug-drug interactions in the Swiss HIV Cohort Study, in: Antiviral Therapy 2010;15(3):413-2
POSITIV 2/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Für Schlagzeilen an der diesjährigen IAS Konferenz in Rom sorgten aufsehenerregende Daten aus der Prävention. Die Wirksamkeit der Therapie als Präventionsinstrument wurde eindrücklich bewiesen. Erfolge mit Mikrobiziden, PrEP, „test and treat“-Strategien sowie Fortschritte mit Impfstoffen sind sehr ermutigend. Es zeichnet sich ab, dass die Epidemie in einigen Bevölkerungsgruppen verlangsamt, in anderen sogar gestoppt werden kann. Es stellt sich die Frage, wiedas in der Praxis umsetzt werden wird.
Am 18. Juli wurden im vollen Plenarsaal die Resultate der HPTN-052 Studie vorgestellt und gefeiert. Diese grosse Studie erbrachte einen eindrücklichen Nachweis für die Wirksamkeit der Therapie in der Prävention.
HPTN-052 kontrollierte ab 2005 insgesamt 1763 sero-diskordante heterosexuelle Paare in Malawi, Zimbabwe, Botswana, Kenya, Südafrika, Brasilien, Thailand, den USA und Indien. Die Einschlusskriterien: Der infizierte Partner (Partner können männlich oder weiblich sein) hat aufgrund hoher CD4-Werte noch keine Therapie-Indikation; der feste Partner, die Partnerin ist HIV-negativ. Die Patienten wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: entweder sofortige antiretrovirale Therapie bei CD4-Werten zwischen 350 und 550/ml, oder abwarten, bis diese gemäss nationalen Richtlinien indiziert war (unter 250 CD4/ml). Der primäre Endpunkt der Studie war die Infektion des festen Partners mit dem Virus des infizierten Partners.
Lange Studiendauer, eindeutige Resultate
Bei einer Beobachtungszeit von durchschnittlich 2 Jahren wurden in der Studie 39 Partner infiziert. Bei 28 Infizierten konnte der Nachweis durch den festen Partner eindeutig bewiesen werden, bei 11 Infizierten wurde eine Infektion innerhalb der Partnerschaft ausgeschlossen. 27 von insgesamt 28 Infektionen innerhalb der Partnerschaft erfolgten in der Gruppe, der noch nicht therapierten Patienten. Interessant ist die eine Infektion in jener Gruppe, deren Partner bei Studienbeginn nicht infiziert waren. Die Neuinfektion wurde aber bereits bei der ersten Nachkontrolle nach 90 Tagen festgestellt. Die Analyse der Tests sprechen für eine nicht ganz frische Infektion. Die Autoren haben aufgrund der Veränderung der HIV-Viren den wahrscheinlichsten Infektionszeitpunkt mit -85 Tagen genau bei Beginn der HIV-Therapie berechnet. Das heisst: während der etablierten Therapie wurde niemand angesteckt. Damit reduziert die HIV-Therapie alleine das Übertragungsrisiko innerhalb der Partnerschaft um 96%. Angekündigt wurden diese Daten bereits Ende Mai, als die Studie aufgrund der eindeutigen Daten vorzeitig abgebrochen wurde. Das ist eine eindrückliche Bestätigung der Annahmen, welche dem 2008 publizierten EKAF-Statement zugrunde liegen.
Zaghafte Zuversicht für die südlichen Länder
Die HPTN-052 Zahlen werden die Diskussionen um Therapieprogramme und -beginn vor allem in den stark betroffenen Ländern des Südens fundamental verändern. Einige Stimmen warnten vor übertriebenem Optimismus: „Wissenschaftler und Aktivisten brauchen noch viel Überzeugungskraft, um Behörden und Geberländer von der Wichtigkeit der Daten und der dringlichen Anpassung von Behandlungsprogrammen in den von HIV am schwersten betroffenen Ländern zu überzeugen“, meinte Dr. Eli Katabira, Präsident der International AIDS Society. „Unterschätzen Sie nicht die Kraft eines wissenschaftlich begründeten Arguments, statt mit den Armen zu fuchteln“, entgegnete Anthony Fauci vom US-amerikanischen National Institute of Health.
Eine weitere Sitzung befasste sich mit den nächsten Schritten, der Herausforderung sogenannte „Behandlung als Präventionsprogramme“ umzusetzen. Die Hauptschwierigkeit dürfte darin bestehen, alle mit HIV infizierten Menschen aufzuspüren. In den meisten Ländern weiss eine Mehrheit der PLWHA nichts von ihrer Infektion. Es sind also möglichst gezielte Testprogramme nötig, mit sofortigem Behandlungsbeginn und unter Sicherstellung der langfristigen Adhärenz.
Viele Kongressteilnehmer waren der Ansicht, dass ein Behandlungsaufschub für Menschen mit HIV die in einer sero-diskordanten Partnerschaft leben ethisch nicht zu verantworten ist. Doch auch in dieser Frage herrschte kein Konsens – in einigen Gegenden der Welt lebt die Mehrzahl der Menschen mit HIV, mit oder ohne Diagnose, nicht in einer solchen Partnerschaft. Soll man diesen die Therapie verweigern, und die anderen bevorzugen?
Auch die Menschenrechte bieten Diskussionsstoff. Die Patienten müssen am Therapieentscheid mitwirken können, und niemand darf aus gesundheitspolitischen Gründen zu einer Therapie gezwungen werden. Gefordert ist jetzt insbesondere die WHO, welche Richtlinien zur Rolle der Therapie in der Prävention erarbeiten muss.
Was bedeuten die Daten für Europa, für die Schweiz?
Einige Länder werden sicher Therapierichtlinien anpassen müssen. Dies sollte mit Umsicht geschehen, sind doch noch nicht alle Nutzen der frühzeitigen Therapie für die Menschen mit HIV geklärt. Die auch in der Schweiz laufende START-Studie wird weiter klären. In der Schweiz ist die frühzeitige Therapie ab Diagnose heute schon möglich, und diese Möglichkeit wird bereits genutzt – auf Empfehlung des Arztes, der Ärztin, oder auf Wunsch der Patienten welche ihren Partner schützen möchten. Es dürfte sich hier in der Schweiz also wenig verändern. Allenfalls wird ein bereits bestehender Trend verstärkt.
Überdenken muss die Schweiz erstens die Präventionsstrategie, und zweitens die Testempfehlungen für schwule Männer mit Risikoverhalten. Die geltende Präventionsstrategie basiert auf der Prämisse „Jeder schützt sich selber“. Das stimmt so nicht mehr; wir können eindeutig etwas tun und Hilfestellungen anbieten die auch der Gesamtgesellschaft nützen. Die Testempfehlungen müssen dringend dem spezifischen Risikoverhalten der schwulen Männer und MSM angepasst werden. Wer viel Verkehr hat, muss öfter an die Boxen: Einmal pro Jahr genügt nicht für alle.
Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP)
Auch hier gab es ihn Rom neue, positive Daten aus zwei Studien mit heterosexuellen Paaren. Die Daten wurden bereits vor der Konferenz angekündigt, die Studien wurden aufgrund der positiven Daten vorzeitig abgebrochen. Die Partner-Studie verglich Tenofovir und Tenofovir/FTC (Truvada) versus Placebo bei sero-diskordanten Paaren in Kenya und Uganda; die TDF2-Studie verglich Truvada gegen Placebo bei heterosexuellen Paaren in Botswana. Die Partners-Studie zeigte einen für Tenofovir eine Schutzwirkung von 62%, für Truvada etwas besser, 73%. In TDF2 war die Schutzwirkung von Truvada 63% insgesamt, jedoch 78% bei den Paaren, welche vor weniger als einem Monat Medikamente bezogen hatten. Dieser Umständ macht erneut die Therapietreue-Problematik beim Einsatz von PrEP deutlich.
Was bedeuten die Daten aus Rom für die Prävention?
Vor allem eines: es wird komplex. Wir wissen jetzt, dass sowohl ein früher Therapiebeginn, der Einsatz von PrEP und vaginale Mikrobizide einen Einfluss auf die HIV-Übertragungsraten haben. Doch mit dem Nachweis der Wirksamkeit einer bestimmten Intervention alleine ist es nicht getan.
Wir müssen verstehen, weshalb bestimmte Interventionen in gewissen Risikogruppen funktionieren und in anderen nicht (gewisse Resultate sind widersprüchlich oder nicht eindeutig). Wir müssen die spezifischen Eigenschaften sexueller Netzwerke, sexuellen Verhaltens und die lokale Epidemiologie verstehen – diese beeinflussen die Wirksamkeit der Interventionen. Und wir müssen insbesondere die Wirksamkeit einer isolierten Intervention mit dem kombinierten Einsatz eines Präventionspaketes vergleichen.
Die „beste“ oder „wirksamste“ Einzelintervention wird es wohl nicht geben – wohl aber das auf die spezifische, lokale Risikogruppe abgestimmte Interventionspaket. Wir brauchen also zusätzliche, lokale Studien welche sich mit diesen Komponenten (Einzelteile) und deren Implementierung befassen. Schliesslich und endlich wollen wir auch ganz einfach wissen „Was bringt’s und was kostet’s?“.
Einhundert bis einhundertfünfzig verhinderte Infektionen bei MSM in der Schweiz bedeuten eine Kostenersparnis von mehr als zwei bis drei Mio. Franken, und diese Zahl kumuliert sich jedes Jahr. Angesichts der Schweizer Fallzahlen und der Daten aus Rom sollte dieses Ziel realistisch sein. Das Erreichen der Zielvorgabe bedingt die Entwicklung der richtigen Studien, verbesserte Surveillance, eine Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Behörden, Ärzteschaft, Forschern, AIDS-Hilfen und Betroffenen und das Erstellen möglichst realistischer epidemiologischer Modelle.
Gefordert sind jetzt viel Nachdenken, gute Planung und eine optimale Abstimmung der Akteure, nicht aber Schnellschüsse. Es gilt auch, die am tiefsten hängenden Früchte zuerst zu pflücken – und das wäre in der Schweiz jene gut 35% der HIV-Patienten ausfindig zu machen, welche heute als nicht diagnostizierte Late-Presenter in die Klinik kommen sowie Menschen mit einer HIV-Primoinfektion zu erkennen, zu beraten und zu therapieren.
Text: David H.-U. Haerry
Der Autor dankt Prof. Pietro Vernazza vom Kantonsspital St. Gallen für die Durchsicht des Manuskripts.
POSITIV 2/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
ForscherInnen der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie und der ETH Zürich haben eine Methode gefunden, den Zeitpunkt einer HIV-Infektion zu ermessen. Das HI-Viruserbgut lieferte ihnen Hinweise auf das Alter der im Körper befindlichen HI-Viren und damit auf den ungefähren Zeitpunkt der HIV-Infektion. Ihre Studie wurde im Januar 2011 publiziert.
Bei vielen HIV-infizierten Menschen ist nicht bekannt, wann sie sich infiziert haben. Das Wissen um den Infektionszeitpunkt wäre einerseits für die Einschätzung und Behandlung von PatientInnen und andererseits aus epidemiologischen Gesichtspunkten von grossem Interesse.
Seit 2000 werden „frische“ HIV-Infektionen im Meldesystem des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) aufgeführt. Auf „frische“ Infektionen weisen jene reaktiven und bestätigt positiven HIV-Tests hin, die während der Primoinfektion eines Patientien gestellt werden, oder solche positive Tests, bei denen durch ein negatives Testresultat innerhalb der letzten sechs Monate zuvor der Infektionszeitpunkt eingrenzt werden kann. Neu ist, dass durch die Untersuchung der Virenvielfalt im Blut von HIV-Positiven rückblickend und auch ohne Hinweise auf frühere negative Tests, bestimmt werden kann, ob eine HIV-Infektion ein Jahr alt oder jünger ist.
Um dies herauszufinden, hat die Forschungsgruppe Daten ausgewertet, die im Rahmen von Resistenztests bei HIV-Positiven der Kohortenstudie routinemässig erhoben werden. Diese Tests untersuchen das HIV-Erbgut, um allfällige Resistenzen auf antiretrovirale Medikamente festzustellen. Wo verschiedene HIV-Stämme vorhanden sind, liefern die Resistenztests nur uneindeutige Resultate. In einer Medienmitteilung zur Studie wird Prof. Dr. Huldrych Günthard zitiert: „Während langer Zeit galt die Unschärfe im Viruserbgut als Abfallprodukt des Tests. Aber wir fragten uns, ob sie ein Mass für die Vielfalt der Viren im Blut sein könnte.“ HI-Viren vermehren sich im Blut sehr schnell und dabei entstehen laufend Mutationen der Viren. Die Anzahl der Mutationen und das Ausmass der Vielfalt kann darum Hinweise darauf liefern, wie lange die Viren sich schon vermehren – mit anderen Worten: wie lange sie schon im Blut existieren. Weil die HIV-Therapie die Vermehrung der Viren stoppt oder reduziert, wurden nur Blutproben von HIV-PatientInnen untersucht, die nicht unter Therapie standen.
In den ersten acht Jahren nach einer HIV-Infektion, so lautet das Resultat der Studie, steigt die Virenvielfalt gleichmässig an, danach flacht die Kurve ab. Durch Vergleiche mit früheren Berechnungen des Infektionszeitpunkts und durch Untersuchungen von Blutproben, bei denen der Infektionszeitpunkt bekannt war, konnten die ForscherInnen einen Wert bestimmen, der mit fast hundertprozentiger Sicherheit auf eine Infektion hinweist, die ein Jahr alt oder jünger ist.
Die neue Methode zur Bestimmung des Infektionszeitpunktes soll in Zukunft routinemässig bei jedem genotypischen Resistenztest angewendet werden. Wann diese Neuerung in Kraft tritt und wer die Kosten für die Untersuchung übernehmen wird, ist noch nicht festgelegt.
Shelley Berlowitz, Aids-Hilfe Schweiz
POSITIV 1/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
Neues aus der Kohortenstudie: Selbstmordraten sind unter HIV-Positiven in der Schweiz stark gesunken
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Jährlich sterben in der Schweiz zwischen 1300 und 1400 Menschen an Suizid. Seit der Einführung der hochaktiven antiretroviralen Therapie (HAART) ist die Suizidrate unter den Menschen mit HIV/Aids in der Schweiz massiv zurückgegangen. Sie ist aber immer noch dreimal so hoch wie in der Schweizer Allgemeinbevölkerung.
Dr. Olivia Keiser und ihr Team vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern hat für die Jahre 1988-2008 die Anzahl der Suizide und die Risikofaktoren unter den HIV-Positiven der Schweizer HIV-Kohorte mit jener in der Gesamtbevölkerung verglichen. Ihre Studie ist 2010 im American Journal of Psychiatry erschienen. Als Grundlage dienten die Daten aus zwei Kohorten: der Schweizerischen Nationalen Kohorte, in der anonyme Gesundheitsdaten aus Volkszählungen und Mortalitätsstatistiken der Schweizer Bevölkerung vernetzt werden, und der Schweizerischen HIV-Kohorte. In der HIV-Kohorte sind seit 1988 rund 40% aller HIV-PatientInnen und 70% aller Aids-Kranken der Schweiz erfasst. 150 HIV-PatientInnen begingen im Zeitraum 1988 bis 2008 Suizid. Für die Studie wurden die Daten von 15‘275 HIV-PatientInnen der HIV-Kohorte verwendet. Zudem wurden für die 150 PatientInnen, die Suizid begangen hatten, medizinischen Fachpersonen einen Fragebogen mit Fragen zu deren psychiatrischen Behandlung, Alkoholmissbrauch und Selbstmordversuchen zugeschickt, 136 davon wurden beantwortet und zurück gesendet.
Die Einführung der hochwirksamen antiretroviralen Therapie (HAART) im Jahre 1996 hatte einen grossen einen Einfluss auf die Selbstmordrate unter HIV-positiven Menschen. Suizide von HIV-Positiven gingen in den Jahren ab 1998 um über 50% zurück. Dabei war der Rückgang unter Männern weit grösser als unter Frauen. Es erstaunt nicht, dass Selbstmorde vor der Einführung von HAART viel häu¬figer waren als heute. Eine HIV-Infektion bedeutete vor 1996 ein sicheres Todesurteil. Heute haben HIV-infizierte Menschen eine vergleichbare Lebenserwartung wie HIV-Negative und können eine gute Lebensqualität aufweisen.
Sowohl in der HIV-Kohorte wie auch in der Allgemeinbevölkerung waren es tendenziell ältere Menschen, Männer und Schweizer BürgerInnen, die suizidgefährdet waren. In der HIV-Kohorte kamen Suizide zudem besonders bei Menschen vor, die in einem fortgeschrittenem Krank¬heitsstadium oder psychiatrischer Behandlung waren, oder die intravenös Drogen konsu¬mierten. 62% HIV-PatientInnen, die Suizid begingen, hatten eine psychiatrische Diagnose – in der Regel wurde diese nach der HIV-Diagnose gestellt. Dabei handelte es sich in erster Linie um Depressionen, Angststörungen, Belastungsstörungen und Psycho¬sen. In den Fragebögen gab das medizinische Personal allerdings in den meisten Fällen die Progression der HIV-Infektion als wahrscheinlichsten Grund für den Selbstmord an. An zweiter Stelle wurden psychosoziale Probleme genannt.
Obwohl die Suizidrate unter HIV-Positiven massiv gesunken ist, ist sie immer noch signifikant höher als jene der Allgemeinbevölkerung. Auch im Vergleich mit PatientInnen mit anderen chronischen Krankheiten haben HIV-Positive ein höheres Suizidrisiko – auch in der Zeit nach HAART. Das dürfte damit zusammenhängen, dass HIV-positive Menschen immer noch tendenziell mehr Stigmatisierung, Diskriminierung und soziale Isolation erleben. Depressionen und Angstzustände sind oft diagnostizierte psychische Lei¬den unter ihnen – alles Risikofaktoren für Suizid. Immerhin wurde eine signifikante Minderheit von 36.5% (vor der Einführung von HAART) und 23.2% (danach) unter den HIV-Positiven mit psychischen Problemen nicht psychiatrisch behandelt. „Ein verstärktes Screening von psychischen Krankheiten bei HIV-Positiven und mehr Zugang zu pharmakologischer und psychologischer Behandlung für HIV-positive PatientInnen wäre durchaus berechtigt“, sagte die Studienleiterin Olivia Keiser. Tatsächlich zeigen die Resultate ihrer Studie, dass HIV-positive Menschen mehr psychologische Unterstützung brauchen und dass vermehrte Aufmerksamkeit auf ihre Suizidgefährdung gelegt werden sollte.
Shelley Berlowitz, Aids-Hilfe Schweiz
1 Olivia Keiser et al: Suicide in HIV-Infected Individuals and the General Population in Switzerland, 1988–2008, in: J Psychiatry 2010; 167:143-
POSITIV 1/2011 © Aids-Hilfe Schweiz
- Details
- Kategorie: Therapie & Gesundheit
Besonders beim Therapiebeginn und bei der Umstellung eines HIV-Medikaments leiden viele HIV-PatientInnen an Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Diese Beschwerden verschwinden in vielen Fällen nach einigen Wochen. Wenn sie besonders schwer oder andauernd sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ihnen begegnen kann. ÄrztInnen und PatientInnen sollten diese Symptome sorgfältig beobachten und miteinander darüber kommunizieren. Nicht immer ist die antiretrovirale Therapie die Ursache für Magen-Darm-Probleme.
Die HIV-Infektion wirkt sich zerstörerisch aus auf das Immunsystem, und das hat in verschiedenen Hinsichten Folgen für die Magen-Darm-Gesundheit. Die Magen-Darmregion enthält die grösste Konzentration von T-Helferzellen, und diese Zellen sind die wichtigsten Ziele von HI-Viren. Das führt zuerst zu einer Schwächung der Immunabwehr in dieser Gegend. Die antiretrovirale Therapie (ART) kann diesen schädlichen Effekten teilweise vorbeugen, bzw. zu einer Verbesserung der Situation führen.
HIV-Medikamente können aber, durch ihre chemische Wirkung, ihrerseits zu Verdauungsproblemen führen, vor allem zu Beginn einer Therapie. Magen-Darm-Effekte sind ein häufiges Problem mit hoch wirksamen medikamentösen Therapien, die HIV-Therapie ist diesbezüglich kein Sonderfall. Ein grosser Teil der HIV-PatientInnen, die eine Therapie beginnen oder umstellen, leidet vorübergehend an derartigen Beschwerden. (1) Die Probleme reichen von Schluckbeschwerden, über Magenschmerzen und Übelkeit bis zu Erbrechen und Durchfall. Bei einigen PatientInnen sind diese Nebenwirkungen so stark und fortdauernd, dass ein HIV-Medikament ausgewechselt wird, wenn das möglich ist. (2) Grundsätzlich gilt, dass Magen-Darm-Probleme zwar für die Betroffenen höchst unangenehm sein können, sie sind aber nur in den seltensten Fällen medizinisch bedrohlich.
Folgen für die Therapietreue!
Probleme mit der Magen-Darmgesundheit sind einer der wichtigsten Faktoren für die Nichteinhaltung der Therapietreue, bzw. für eine Therapieumstellung. Viele PatientInnen treffen eigene Massnahmen, um Durchfall, Erbrechen und andere derartige Symptome unter Kontrolle zu bringen. Oft wird dabei die Dosierung der HIV-Medikamente verändert, oder es werden spezielle Medikamente eingesetzt, ohne dass der behandelnde Arzt darüber informiert ist. (3) Dies kann zu Therapiekomplikationen führen bis hin zum Therapieversagen. Es ist deshalb wichtig, dass PatientInnen Verdauungsprobleme mit dem Arzt besprechen und dass HIV-Spezialisten diese Rückmeldungen ernst nehmen.
Es existieren diverse Möglichkeiten, um Magen-Darm-Problemen im Zusammenhang mit einer HIV-Therapie wirkungsvoll zu begegnen. Voraussetzung für deren Einsatz ist ein funktionierender Informationsfluss zwischen HIV-Arzt und PatientIn. Es ist ein Vorteil in dieser Situation, wenn HIV-ÄrztInnen klare Vorstellungen haben über die bestehenden - nicht immer schulmedizinischen - Alternativen und PatientInnen zur Ernährungsberatung verhelfen können.
Wenn Magen-Darm-Beschwerden während eines Monats nicht bessern, sollten medizinische Massnahmen ergriffen werden. Nach drei Monaten sollte in der Regel eine Umstellung der ART vorgesehen werden. Nicht in allen Fällen kann das Problem behoben werden. Für PatientInnen mit Therapieversagen, bei denen die Kombination der ART schon mehrfach umgestellt worden ist, bestehen möglicherweise keine Alternativen.
Durchfall
Durchfall (Diarrhoe) gehört zu den verbreitetsten Magen-Darm-Nebenwirkung der ART. In einer Studie der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie (SHCS) gaben knapp 30% der 1078 befragten PatientInnen dieses Problem an (4). Durchfall unter ART tritt hauptsächlich nach der Einnahme von Proteasehemmern, bzw. im Anschluss an eine Mahlzeit nach der Medikamenteneinnahme auf. (v.a. bei Saquinavir [Invirase], Fosamprenavir [Telzir], Lopinavir [Kaletra]; weniger Atazanavir [Reyataz] und Darunavir [Prezista]). Die Wirkung aller PIs wird normalerweise mit Ritonavir (Norvir) verstärkt ("geboosted"), und auch Ritonavir kann, je nach Dosierung, Duchfall verursachen.
Auch andere Medikamente, vor allem Antibiotika und Chemotherapien, aber besonders auch Infektionen der Magen-Darmregion können zu Durchfall führen.
Andauernder Durchfall ist, ebenso wie Erbrechen, grundsätzlich mit Flüssigkeits- und Nährstoffverlust verbunden. Wenn das Problem anhält, müssen deshalb Flüssigkeit und Nährstoffe ergänzt werden. Ausserdem muss kontrolliert werden, ob die ART-Medikamentenspiegel aufgrund von Durchfall oder Erbrechen beeinflusst werden. Wenn man im Zusammenhang mit diesen Symptomen ungewollt und merklich Gewicht verliert, ist das immer ein Alarmsignal und sollte mit dem Arzt besprochen werden.
Durchfall kann in vielen Fällen durch eine Anpassung der Ernährungsgewohnheiten vermindert werden. Zum Beispiel, indem die HIV-Medikamente, bei denen dies möglich ist (alle PIs in Tablettenform; nicht Fosamprenavir-Saft), zusammen mit einer kleinen Mahlzeit eingenommen werden statt auf nüchternen Magen. Ausserdem sollte auf Speisen wie Sauerkraut, Pflaumen und künstliche Süssstoffe verzichtet werden. Auch die bewährten Hausmittel (zerdrückte Bananen und geraffelte Äpfel) helfen in vielen Fällen. Generell hilft weniger fettige Ernährung Probleme mit Durchfall zu vermeiden. Durchfälle, die von Proteasehemmern herrühren, konnten in vielen Fällen mit Kalziumgabe vermindert werden. (6)
Nützen die Hausmittel nichts, sind diverse rezeptfreie und rezeptpflichtige Medikamente verfügbar, welche die Darmschleimhaut beruhigen, die Darmbewegung hemmen, oder die Stoffaufnahme im Darm verlangsamen können. In schweren Fällen kann zu Loperamid oder zu Opiumtinktur gegriffen werden, die beide stark stuhlhemmend wirken. Beide sind rezeptpflichtig.
Nach einem Durchfall kann der Wiederaufbau der Darmflora durch probiotische Nahrung (z.B. Hefepräparate) unterstützt werden.
Übelkeit und Erbrechen
Übelkeit und Erbrechen sind generell verbreitete Beschwerden und sie können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Dazu gehören auch antiretrovirale Medikamente. Mehr als ein Drittel der PatientInnen, die mit einer HIV-Therapie beginnen, leiden vorübergehend an mehr oder weniger starker Übelkeit, die oft mit Erbrechen verbunden ist. Diese unangenehme und belastende Nebenwirkung dauert in den meisten Fällen nicht länger als einige Wochen bis Monate, dann passt sich der Körper den Wirkstoffen an.(2) Man geht auch hier davon aus, dass nicht der antivirale Effekt der HIV-Medikamente diese Nebenwirkungen hervorruft, sondern ihre chemische Wirkung auf die Magenschleimhaut. Und auch für diese Nebenwirkungen sind hauptsächlich einige Ritonavir-verstärkte Proteasehemmer bekannt (v.a. Lopinavir und Fosamprenavir, weniger Atazanavir, Darunavir, Saquinavir). Unter den nukleosidalen Hemmern der reversen Transkriptase (NRTI) ist besonders Zidovudine für diesen Effekt bekannt.
Übelkeit und besonders fortdauerndes Erbrechen müssen in der Phase des Therapiebeginns sorgfältig beobachtet werden. Wichtig ist, festzustellen, ob diese Erscheinungen in der Tat von den HIV-Medikamenten herrührt, oder ob es andere medizinische Probleme gibt. Je nachdem können passende Massnahmen ergriffen werden. Medizinisch gesehen gilt für Übelkeit und Erbrechen generell, dass ein Arztbesuch immer angezeigt ist, wenn die Beschwerden nicht innert ein bis zwei Tagen vorübergehen.
Hausmittel wie Ingwer, Kamille, feuchtwarme Bauchumschläge, Schonkost sind für ihre wohltuende Wirkung bekannt. In schwereren Fällen können auch Medikamente angewendet werden. Domperidon (z.B. Motilium) und Metoclopramid (z.B. Paspertin) wirken fördernd auf die Bewegung des Magen- Darmtraktes, Dimenhydrinat (z.B. Vomex) und so genannte Neuroleptika wie Promethazin (Atosil) wirken auf das Gehirn.
Sodbrennen
Bei erwachsenen Menschen ist das charakteristische, saure Aufstossen im Bereich hinter dem Brustbein unabhängig von einer HIV-Therapie ein relativ verbreitetes Problem. Im Unterschied zur Übelkeit ist Sodbrennen in indirekter Effekt von ART-Medikamenten. Es kann z.B. bei fortdauernder Übelkeit und Erbrechen als Nebenerscheinung auftreten. Der Grund ist ein unvollständiger Verschluss der Magenpforte (Kardia) in Richtung Speiseröhre (Kardiainsuffizient). Dies kann verschiedene Ursachen haben und bedingt bei chronischem Auftreten eine genauere medizinische Abklärung.
Sodbrennen hat aber häufiger mit falscher Ernährung zu tun. Ein Übermass an fettigem Essen, Schokolade und anderen Süssigkeiten, sowie Alkohol (v.a. Weisswein) und Nikotin können das Schliessvermögen der Magenpforte vermindern. Auch Pfefferminztee hat grundsätzlich diesen Effekt. Starkes Übergewicht, bzw. zu reichhaltiges Essen kann ausserdem das Schliessvermögen der Kardia übersteigen.
Da der chronische Rückfluss von Magenflüssigkeit in die Speiseröhren langfristig zu Entzündungen und sogar zu Karzinomen führen kann, muss dieses Problem rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Entweder werden dazu Säureregulatoren eingesetzt (Omeprazol, Cimetidin, Famutidin) oder Mittel zur Förderung der Darmaktivität (Domperidon, Metoclopramid).
Der Einsatz von Säureregulatoren kann Auswirkungen auf die ART-Wirkstoffe haben, speziell beim Einsatz von Atazanavir. Mit diesem Medikament dürfen keine Säurehemmer eingenommen werden. Die anderen ART-Wirkstoffe können dagegen, mit genügendem Zeitabstand zu Säurehemmern, eingenommen werden.
Magenschmerzen (Gastritis)
Die Gastritis ist eine Entzündung der Magenschleimhaut und diese kann durch Medikamente, auch durch eine HIV-Therapie, verursacht sein. Gastritits geht typischerweise einher mit Brennen, Stechen, Übelkeit, Krämpfen, oder dumpfe Schmerzen und Völlegefühl. Gastritis kann, wie Sodbrennen, durch Säureregulatoren bekämpft werden. Wie oben erwähnt gilt auch hier, dass die Einnahme entsprechender Gegenmittel in jedem Fall mit einer HIV-Therapie abgestimmt werden muss.
Rainer Kamber, Aids-Hilfe Schweiz
(1) Brenchley JM, Schacker TW, Ruff LE et al., «CD4+ T cell depletion during all stages in HIV disease occurs predominantly in the gastrointestinal tract», in Journal of Experimental Medicine, Sept. 2004, 6(200), S. 749–59; Kotler DP, «HIV infection and the gastrointestinal tract», in AIDS, 2005, 19(2), S. 107–17.
(2) Trottier B, Walmsley S, Reynes J et al., «Safety of enfuvirtide in combination with an optimized background of antiretrovirals in treatment-experienced HIV-1-infected adults over 48 weeks», in JAIDS, 2005, 40(4), S. 413–21.
(3) Hill A, Balkin A, «Risk Factors for Gastrointestinal Adverse Events in HIV Treated and Untreated Patiens», in AIDS Reviews, 2009, 11(1), 30–38; Guest JL, Ruffin C, Tschampa JM et al, «Differences in Rates of Diarrhea in Patients with Human Immunodeficiency Virus Receiving Lopinavir-Ritonavir or Nelfinavir», in Pharmacotherapy, 2004, 24(6), S. 727–35.
(4) O’Brien M, Clark R, Besch C et al., «Patterns and correlates of discontinuation of the initial HAART regimen in an urban outpatient cohort», JAIDS, 2003, 34(4), S. 407–14.
(5) Heath KV, Singer J, O’Shaughnessy, MV et al., «Intentional Nonadherence Due to Adverse Symptoms Associated With Antiretroviral Therapy», in JAIDS, Okt. 2002, 31(2), S. 211–17; Siddiqui U, Bini EJ, Chandarana K et al., «Prevalence and Impact of Diarrhea in the Era of Highly Active Antiretroviral Therapy», in Journal of Clinical Gastroenterology, 2007, 41(5), S. 484–90.
(6) Keiser O, Fellay J, Opravil M et al., «Adverse events to antiretrovirals in the Swiss HIV Cohort Study: effect on mortality and treatment modification», in Antiviral Therapy, 2007, 12(8), S. 1157–1164.
(7) Bonfanti P, Valsecchi L, Parazzini F, «Incidence of Adverse Reactions in HIV Patients Treated With Protease Inhibitors: A Cohort Study», in JAIDS, März 2000, 23(3), S. 236–45.
(8) «Magen-Darm- und Leberbeschwerden – Nebenwirkung der HIV-Therapie», MEDINFO Medizinische Informationen zu HIV und AIDS, Nr. 73, Hg. Aidshilfe Köln 2010, www.hiv-med-info.de. Die Deutsche Aidshilfe führt eine Website, die eine Reihe wertvoller Informationen zum Umgang mit Magen-Darm-Beschwerden enthält: www.hiv-wechselwirkungen.de.
Swiss Aids News 2, Juni 2010, www.aids.ch
Swiss Aids News 2, Juni 2011, www.aids.ch
Seite 9 von 11