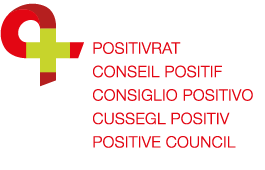Aktuell
- Details
- Kategorie: Medienmitteilungen
Die französische Gesundheitsministerin verkündet am 23. November die Zulassung von PrEP in Frankreich ab 2016. Die Kosten werden vom Gesundheitssystem übernommen. Damit ist Frankreich das erste Land ausserhalb der USA, welches PrEP zulässt. Wir gratulieren.
- Details
- Kategorie: Positionen
Die letztjährige LOVE LIFE-Kampagne hat einiges an Kritik provoziert und viel Aufmerksamkeit erhalten. Dieses Jahr ist es auffällig still. Doch wie steht es um die aktuelle Kampagne?
Ein schweissbedeckter Mann oder eine fiebrig schwitzende Frau in weissen Bettlaken sind zurzeit auf Plakaten zu sehen. Vier Beine schauen unter der Bettdecke hervor. Dazu der Claim “Fieber nach Sex ohne Gummi? Sprich mit deinem Arzt über HIV.”
So sieht die neue LOVE LIFE-Kampagne aus. Zielpublikum: Allgemeinbevölkerung, also Herr und Frau Schweizer. Während die letztjährige Kampagne durch nackte Haut zu provozieren suchte, erfolgreich der alten Werber-Weisheit „Sex sells“ folgend – bleibt es dieses Jahr auffällig still. Wir wollen trotzdem Stellung nehmen.
An den aktuellen Plakaten fällt uns vor allem eines auf: Wir sehen offensichtlich kranke Menschen, die das Bett hüten müssen. Und wir fragen uns: Ist das wirklich die korrekte Botschaft für Herr und Frau Schweizer? Nicht nur im Hinblick auf eine aktuelle Studie, die befürchten lässt, dass sich Personen mit anderen als Grippesymptomen oder keinen Symptomen in falscher Sicherheit wiegen (wir berichteten an dieser Stelle schon darüber). Sondern auch das Bild, das von Betroffenen vermittelt wird: das von kranken Menschen.
Jahrelang hat man versucht, die Öffentlichkeit aufzuklären, dass man den Menschen ihre HIV-Infektion nicht ansieht. In den letzten Jahren gingen die Bemühungen, insbesondere der Aids-Hilfe Schweiz, dahin, die breite Bevölkerung und die Arbeitgeber aufzuklären, dass Menschen mit HIV heute voll leistungsfähig sind und nicht öfter krank im Bett liegen als Menschen ohne HIV. Daten dazu gibt es: Die meisten Menschen mit HIV arbeiten, der Grossteil von ihnen in einem Vollzeitpensum.
Weiter wird erneut mit dem Claim “Bereue nichts“ gearbeitet. Dies hatten wir schon bei der letztjährigen Kampagne kritisiert (http://tinyurl.com/po3nzp3). Sollen Menschen mit HIV nun ein Leben lang bereuen? Wie angebracht ist es, mit moralischen Begriffen zu operieren? Wo doch viele Menschen mit HIV Stigma und Schuld verinnerlicht haben? Wo doch Moral in der Prävention leicht zur Ausgrenzung führt? Auf unser Schreiben an die Kampagnenleitung wurde belehrend geantwortet: Der Slogan "Ich bereue nichts. Dafür sorge ich" sei „zukunftsgerichtet und schliesst HIV-infizierte Menschen nicht aus.“ Und es sei „nicht korrekt zu behaupten, dass die neue LOVE LIFE-Kampagne mit der Umkehrung der 3. Aussage (der oben erwähnte Slogan, die Red.) HIV-Betroffenen Schuld zuweist.“ Das Gefühl von Betroffenen wird von der Kampagnenleitung also als Behauptung gewertet, die falsch sei. So fühlt man sich wohl kaum ernst genommen.
Hat die Vorgängerkampagne STOP AIDS bewusst auf Zeigefinger-Botschaften verzichtet, wird heute offenbar damit gearbeitet. Das ist bedauerlich, denn Diskriminierung und Ausgrenzung von Betroffenen verhindert eine effektive Prävention. Wer will sich testen lassen, wenn er bei einem positiven Testresultat von der Gesellschaft geächtet wird?
Uns scheint: Zusammen mit den griffigen und richtigen Botschaften ist der Kampagnenleitung leider das Fingerspitzengefühl für das Thema abhanden gekommen. Prävention zu betreiben, ohne Menschen auszugrenzen und ohne Moral und moralische Begriffe wie Reue (wo die Frage der Schuld nicht fern ist) zu bemühen, das hatte frühere Kampagnen ausgezeichnet. Es wäre zu wünschen, dass die Sensibilität für das heikle Thema künftig wieder zu spüren wäre. Und dass die Stimmen von Betroffenenseite ernst genommen werden.
Bettina Maeschli / November 2015
- Details
- Kategorie: Positionen
Alle zwei Jahre im Herbst ist es soweit: Die europäische Aids-Konferenz geht mit 3-4’000 Delegierten über die Bühne. Nach Belgrad 2011 und Brüssel 2013 ist heuer Barcelona an der Reihe.
Die Austragungsorte müssen nicht mit dem Buchstaben B beginnen – jede grössere europäische Stadt mit einem guten Konferenzzentrum kann sich bewerben. Trotzdem ist der Austragungsort mit Spanien heuer besonders passend. Spanien erlebte in der Wirtschaftskrise einige Probleme im Gesundheitssystem (dieses fällt unter die Kompetenz der Regionen), und Spanien hat sehr viele mit Hepatitis-C koinfizierte Patienten.
Damit ist ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz bereits genannt. Die neuen HCV-Medikamente sind auch in Spanien sehr wichtig, doch mit dem Therapiezugang will es nicht so richtig klappen – die Gründe sind vielschichtig. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Prävention und hier vor allem die Prä-Expositionsprophylaxe PrEP. Seit dem vorzeitigen Abbruch der PROUD- und IPERGAY-Studien ist das Thema in aller Munde. Ko-Infektion mit Tuberkulose und Behandlungsstandards in Europa sind weitere Themen.
Aidsmap berichtet laienverständlich und in mehreren Sprachen direkt aus der Konferenz (englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch und russisch). Das Bulletin kann man hier abonnieren: http://www.aidsmap.com/eacs2015/Conference-bulletins/page/2997088/
Der Newsletter POSITIV ist vor Ort mit dabei – wir werden in der nächsten Ausgabe berichten.
David Haerry
- Details
- Kategorie: Positionen
Position Positivrat Schweiz
Die WHO empfiehlt sie, die European AIDS Clinical Society will sie, die Amerikaner machen es schon lange – Wir wollen die PrEP für die Schweiz.
Wenn sich fast alle einig sind, müsste man eigentlich kein Lobbying machen. Aber beim Thema PrEP ist schon immer alles anders gewesen. Noch selten hat ein Thema über so viele Jahren immer wieder dieselben Kontroversen produziert. In der Schweiz ist die Debatte in vollem Gang, und beim eigentlichen Zielpublikum, den Männern, die Sex mit vielen Männern haben und die es mit dem Gummi drum nicht immer schaffen, ist sie noch gar nicht angekommen.
Wer soll eine PrEP kriegen?
- Alle HIV-negativen Männer und Transgender, die Sex mit Männern haben und die mit Gelegenheitspartnern Kondome nicht konsequent einsetzen.
- Alle HIV-negativen Männer und Transgender, die Sex mit Männern haben und die nicht therapierte HIV-positive Partner haben.
- HIV-negative Männer, die kürzlich eine sexuell übertragbare Krankheit hatten oder eine PEP brauchten, sollen auf PrEP angesprochen werden.
- Bei HIV-negativen heterosexuellen Frauen und Männern, die Schwierigkeiten haben, Kondome immer einzusetzen und die nicht therapierte HIV-positive Partner haben, soll man eine PrEP erwägen.
Wer soll eine PrEP verschreiben?
- Ausschliesslich Ärzte, die Erfahrung mit dem Verschreiben von HIV-Medikamenten haben. Die PrEP Benutzer sollen klinisch überwacht werden. Zudem brauchen sie ein Begleitprogramm.
Wer soll bezahlen?
- Im Moment sind es in der Schweiz die Patienten selber. Die Diskussion muss aber offen und sorgfältig geführt werden – eine PrEP muss für alle, die sie brauchen, zugänglich und erschwinglich sein.
Was ist noch zu beachten?
- Die PrEP funktioniert nur, wenn sie genommen wird. Die Patienten brauchen Adhärenzunterstützung.
- Die Patienten sollen über die Wirkungsweise von PrEP beraten und aufgeklärt werden. Sie müssen wissen, dass die PrEP nur vor einer HIV-Infektion, nicht aber vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Sie sollen wissen, dass Medikamente Nebenwirkungen haben können.
- Die PrEP ist keine Dauermassnahme fürs ganze Leben.
- Viele MSM nehmen Drogen beim Sex. Drogen, inklusive Alkohol, spielen beim ungeschützten Sex eine treibende Rolle. Die Checkpoints und die Kliniken müssen hier ihr Angebot ausbauen und Abstinenzprogramme entwickeln und anbieten.
- Aus ethischer Perspektive darf eine als wirksam anerkannte Massnahme den Patienten nicht vorenthalten werden.
- Frankreich führt die PrEP ab 2016 ein, das Sozialversicherungssystem übernimmt die Kosten. Die französischen Überlegungen und Erfahrungen sind zu berücksichtigen.
Zürich, 25. November 2015
- Details
- Kategorie: Positionen
Fast 23 Jahre nach dem EWR-Nein kann die Swissmedic endlich vertraulichen Informationsaustausch mit den europäischen Behörden pflegen. Die am 10. Juli 2015 unterzeichnete Vereinbarung verbessert die Arzneimittelüberwachung in der Schweiz.
Ganz im Stillen erschien Ende Juli eine lapidare Meldung auf der Swissmedic Webseite – kaum eine Zeitung hat die Nachricht zur Kenntnis genommen. Möglicherweise wollte die eine oder andere Seite die Neuigkeiten so diskret wie möglich verbreiten. Für die Schweizer Patienten ist die seit langem angestrebte Vereinbarung aber ein echter Durchbruch.
Ein wenig Hintergrund: Alle europäischen Länder, inklusive der EFTA-Mitglieder Liechtenstein, Norwegen und Island, arbeiten seit 1995 mit der europäischen Medikamentenagentur unter einem Dach. Dies wäre Bestandteil der vom Schweizer Stimmbürger abgelehnten EWR-Vorlage gewesen. Wie wichtig dieser Informationsaustausch ist, zeigte sich besonders deutlich während der Schweinegrippe-Pandemie von 2009/2010: Alle Europäer waren am gleichen Tisch, nur die Schweiz musste anstehen (das heisst: sie durfte damals ausnahmsweise mit am Tisch sitzen).
Seit dieser Erfahrung haben sich die Bemühungen verstärkt, eine vertrauliche Zusammenarbeit der Gesundheitsbehörden doch möglich zu machen. Damit können die beiden Behörden nicht-öffentliche Informationen zur Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit von Heilmitteln austauschen, die in der Schweiz oder der EU entweder zugelassen oder im Zulassungsverfahren sind. Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre und kann verlängert werden. Beide Behörden werden profitieren, vor allem aber die Schweizer Patienten – die europäischen Zulassungsverfahren beginnen nämlich in der Regel etwas früher, und der Informationsaustausch könnte die Schweizer Zulassungsverfahren unterstützen.
David Haerry / Oktober 2015
Seite 4 von 9